ist Religionslehrerin und Pastoralassistentin im Südburgenland, derzeit in Elternkarenz.
Ein Same wurde gesät

Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis der Synode?
Roque Paloschi: Für mich war es eine große Erfahrung eines gemeinsamen Weges. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, weil es eine Option für die Schöpfung gibt. Die Kirche hat eine Selbstverpflichtung gefunden auf dem Weg, den sie vorher schon gegangen ist – etwa bei der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz im kolumbianischen Medellin 1968, wo sie sich auf die vorrangige Option für die Armen festlegte, sich auf die Seite der Unterdrückten stellte und soziale Ungerechtigkeiten in Lateinamerika anprangerte.
Im Schlussdokument wird festgehalten, der indigenen Bevölkerung auf Augenhöhe zu begegnen. Was sollte nun geschehen, um ihre Geschichte und ihre Kultur zu wahren?
Paloschi: Die Menschen müssen ihre Arroganz ablegen. Im Abschlussdokument geht es um den Respekt gegenüber den indigenen Völkern. Wir sprechen hier von alten Kulturen, die seit Jahrtausenden in der Amazonasregion leben. Dieses Gebiet in Südamerika mit siebeneinhalb Millionen Quadratkilometern ist ein wichtiges Ökosystem für die ganze Welt, das es zu schützen gilt. Die Indigenen stellen sich die Frage: Was für eine Art von Entwicklungsmodell ist das, das den Wald zerstört, das die Flüsse verschmutzt, das Viele ausbeutet und Wenigen hohe Profite bringt? Es braucht, wie der Papst sagt, eine Kultur des sich Begegnens auf Augenhöhe. Dieser Planet ist unser gemeinsames Haus, für das wir Sorge tragen – so steht es auch in der Umweltenzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus. Für neue Wege einer ganzheitlichen Ökologie müssen wir global denken und global handeln.
Wie können Indigene konkret gestärkt werden?
Paloschi: In erster Linie kann man sie stärken, indem ihre Rechte, die in der brasilianischen Verfassung verankert sind, geschützt und ihnen nicht, wie es leider geschieht, verweigert werden. Die indigene Bevölkerung leidet unter Diskriminierung; man begegnet ihnen mit Vorurteilen; man verweigert ihnen ihre Rechte auf Sprache und Kultur; ihr Land, das ihnen zusteht, wird ihnen wegen wirtschaftlicher Gier gewaltsam weggenommen – dabei werden sie bedroht, vertrieben und getötet.
Von den zerstörerischen Bränden in Amazonien sind zunehmend Gebiete der indigenen Bevölkerung betroffen. Man will sie erschließen, um u. a. an wertvolle Rohstoffe zu gelangen ...
Paloschi: Ja, das Abbrennen des Regenwaldes ist extrem kriminell. Solche Verbrechen müssen bestraft werden; doch die Mühlen des Rechtssystems mahlen langsam und es kommt immer wieder zu Lockerungen von Umweltgesetzen. Präsident Jair Bolsonaro und seine Regierung haben diese Brandrodungen angestiftet. Dahinter stehen wirtschaftliche Profite. Bolsonaro hat keinen Respekt gegenüber den indigenen Völkern. Ihre Landrechte werden nicht geschützt. Seine Äußerungen schüren Hass und fördern den Landraub.
Im Synoden-Schlussdokument wurde mehrheitlich dafür gestimmt, Voraussetzungen zu schaffen, dass in entlegenen Regionen verheiratete Diakone zu Priestern geweiht werden können. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag?
Paloschi: Wir sind dabei, einen Weg zu finden auf der Straße der Synodalität, einen Weg, den wir vor uns liegend gemeinsam in Ruhe gehen können. Ob der Papst den Weg für verheiratete Priester in Amazonien freigibt, wird sich zeigen. Wir sind ja nicht nach Rom gekommen, um zu ernten. Wir sind nach Rom gekommen, um den Samen auszusäen und das Ausgesäte gemeinsam zu pflegen, damit dieser Weg weitergegangen werden kann. Dazu braucht es Abgestimmtheit. Es ist wie in einer Beziehung – es braucht Zeit. Du kannst nicht nach der ersten Begegnung gleich heiraten. Das muss sich entwickeln und aufbauen.
Haben Sie Hoffnung, dass dieser gemeinsame Weg fruchtbar werden kann?
Paloschi: Ja, darauf vertraue ich. Für manche Dinge wurde der Weg geöffnet. Jetzt heißt es abwarten, wie sich der Prozess entwickelt. Es geht um Wünsche und es gibt Vorschläge, die mit viel Konsens und wohlüberlegt gefunden wurden. Der Papst wird entscheiden. Niemand spricht dem Zölibat seinen Wert ab. Es stellt sich die Frage, was ist wichtiger: der Zölibat oder das Recht der Christen auf Eucharistie, auf die Sakramente.
Die Synode bezieht sich auf die Amazonasregion, wo es riesige Gebiete gibt mit zu wenigen Priestern. Können Sie sich vorstellen, dass diese Empfehlung auch einmal in Europa gelten könnte?
Paloschi: Der Hintergrund in dieser Frage sind die großen Distanzen in Amazonien. Ein Priester ist oft eine Woche z. B. mit dem Boot unterwegs, um in entlegene Regionen zu kommen. Das sind große Herausforderungen. Die Frage ist, wollen wir eine Kirche, die nur zu Besuch kommt, oder wollen wir eine Kirche, die vor Ort verankert ist. Heute haben wir eine Besuchskirche. Es braucht einen Schritt hin zu einer Kirche, die präsent ist, um ihre Aufgabe zu leben. Biblisch gesprochen: Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Es braucht jemanden, der ordinierend, als Priester geweiht, in Amazonien vor Ort ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssten von Vorarlberg, Tirol oder Oberösterreich nach Wien zu einer Eucharistiefeier fahren.
Für Frauen sieht es im Abschlussdokument anders aus als für Männer. Es wurde zwar ein Amt für weibliche Gemeindeleiterinnen vorgeschlagen; aber die Frage zur Weihe von Diakoninnen soll lediglich weiter erörtert werden. Was halten Sie davon?
Paloschi: Für die gesamte Kirche im Amazonasgebiet ist die Präsenz der Frau ganz entscheidend. In Wirklichkeit üben sie schon einen diakonischen Dienst aus. Aber es geht um mehr als um Ämter in dieser Frage. Es geht um die Wertschätzung und Anerkennung der Frau. Wie gesagt, wir sind nicht zu dieser Synode gekommen, um Früchte zu ernten. Daher sehe ich diesen Vorschlag nicht als Niederlage an. Wichtig ist, dass der Same ausgesät ist, um zu keimen, zu wachsen und irgendwann Früchte zu tragen.
In einer Kirche nahe des Vatikans wurden Holzfiguren schwangerer Frauen ausgestellt als Symbol für das Leben und die Natur. Sie wurden zum Teil als „Götzenbilder“ bezeichnet und von Unbekannten in den Tiber geworfen. Was sagen Sie zu diesem Angriff?
Paloschi: Es war eine Attacke, die uns die Unfähigkeit aufzeigt, andere Kulturen wertzuschätzen. Diese Dämonisierung, Abwertung und Anfeindung ist auch in Brasilien selber stark vorhanden, ganz besonders gegenüber afro-brasilianischen Traditionen. Dahinter steht ein Konzept, das andere Weltanschauungen und Sichtweisen einfach nicht zulässt und abwertet. Dieser Vorfall war zum Schämen. «





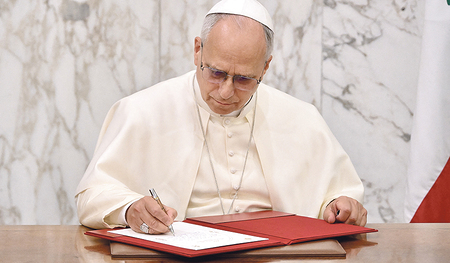


 Jetzt die
Jetzt die