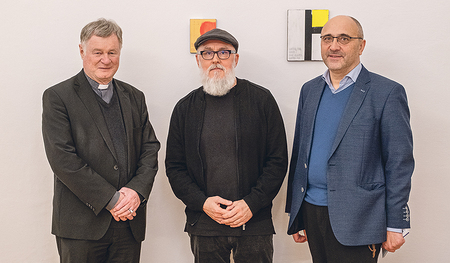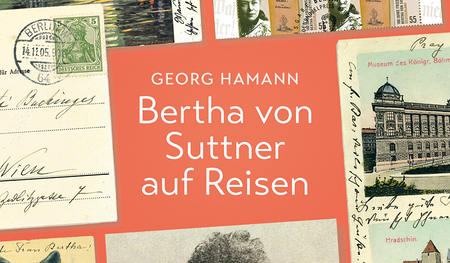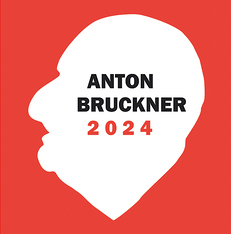„Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“

In den Filmen der in Skopje geborenen Regisseurin Teona Strugar Mitevska spielen schwierige Familienverhältnisse eine große Rolle, die stets in bemerkenswerten Frauenschicksalen gespiegelt werden.
Auch in ihrem neuen Film „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“, der übrigens wie alle anderen Spielfilme von Mitevska beim Crossing-Europe-Festival in Linz gezeigt wurde, kämpft eine Frau um ihr Recht zur Selbstbestimmung in einer Gesellschaft, die sich noch immer an patriarchalischen Lebensmodellen orientiert. Das Drehbuch beruht auf einer Begebenheit aus dem Jahr 2014, als eine junge Frau in der Nähe von Štip im Osten Mazedoniens im Rahmen einer Dreikönigsprozession ein Kreuz aus dem kalten Fluss fischte, das der für den Ort zuständige Priester vorher hineingeworfen hatte. Problematisch im Sinne der Tradition ist, dass bei diesem Ritual nur Männer zugelassen sind. Die Aktion der jungen Frau sorgte 2014 für einen gehörigen Wirbel, der zur Folge hatte, dass die Frau mit ihrer Mutter nach London emigrieren musste. Dieser Vorfall bildet die Basis für einen Film, der nicht als Sozialstudie konzipiert ist, sondern mit komödiantischen Mitteln das Porträt einer archaischen Gesellschaft liefert, die verzweifelt versucht, fragwürdige Traditionen am Leben zu erhalten.
Eine mutige Frau
Dass Petrunya, so heißt die Frau in Mitevskas Film, das Kreuz aus dem Fluss fischt, ist einerseits ihrem Charakter geschuldet, der von Spontaneität und Nonkonformität geprägt ist. Anderseits kann ihre Aktion auch als verzweifelte Reaktion auf ein unmittelbar vorher stattgefundenes demütigendes Bewerbungsgespräch gesehen werden, weil ja, so besagt es die Legende, das Kreuz demjenigen, der es aus dem Fluss fischt, im kommenden Jahr Glück und Gesundheit bringen soll. Petrunya ist 31, hat ein abgeschlossenes Geschichtestudium, wohnt noch bei ihren Eltern und soll sich auf Drängen ihrer Mutter in einer Firma bewerben, indem sie sich für einige Jahre jünger ausgibt. Während der Vater verständnisvoll wirkt, kritisiert die Mutter ständig das Übergewicht ihrer Tochtert und deren Antriebslosigkeit. Petrunyas Aktion führt dazu, dass sie auf eine Polizeistation geführt wird, weil sie vor der aufgebrachten Menge geschützt werden muss. Außerdem soll sie dazu gezwungen werden, das Kreuz den kirchlichen Würdenträgern zurückzugeben.
Die Handlung, die sich in der Folge fast ausschließlich auf der Polizeistation abspielt, gewinnt nach und nach kafkaeske Züge, weil sich einerseits die Medien in der Figur einer feministisch orientierten Journalistin einschalten, die sich permanent im Clinch mit ihrem desinteressierten Kameramann und (am Telefon) mit ihrem Ex-Mann befindet. Im Hintergrund versucht der Polizeichef einen Deal mit dem Priester auszuhandeln, um den Fall möglichst ohne großes Aufsehen über die Bühne gehen zu lassen. Petrunya jedoch gibt nicht nach und wird immer selbstbewusster in ihrer Überzeugung, dass das Kreuz ihr gehört. Der protokollierende Polizist zeigt für ihr Verhalten mehr als nur Sympathie: „Ich wünschte, ich hätte Ihren Mut.“
Auf unterhaltsame Weise entlarvt Mitevskas Film überholte Traditionen. Das Bild des auf der Schreibmaschine tippenden Polizisten im Kontrast zu dem YouTube-Video, das von der Aktion Petrunyas in den sozialen Medien kursiert, kann sinnbildlich für das Aufeinanderprallen zweier Welten stehen. Petrunyas Handeln bringt diesen Bruch auf den Punkt.