
Vom Preis und vom Wert der Milch

Der Milchpreis, also der Auszahlungspreis für Milch an die Bauern, richtet sich nach Angebot und Nachfrage. „Es gibt eine Reihe verschiedener Milchsorten, wie GVO-freie Qualitätsmilch, Biomilch, Heumilch, Bioheumilch und so weiter, die unter unterschiedlichen Auflagen und Vorgaben erzeugt werden“, erklärt Michael Wöckinger, Referent für Milchwirtschaft der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. „Aufgrund der damit zusammenhängenden unterschiedlichen Aufwendungen braucht es Unterschiede bei den Auszahlungspreisen.“
Die Erzeugungskosten seien immer betriebsindividuell und würden unter anderem mit dem jeweiligen technischen und menschlichen Einsatz zusammenhängen. Auf das Marktgefüge wirken auch die Einflüsse von EU-Binnenmarkt und Weltmarkt.
Viele Einflussfaktoren
Auf der Angebotsseite seien unter anderem Witterungseinflüsse oder Futterwachstum, Betriebsmittelkosten oder Tiergesundheit entscheidende Faktoren. Zudem bestimmen auch Bevölkerungswachstum, Ernährungsgewohnheiten und gesellschaftliche Ansprüche den Absatz mit.
„Die steigende Qualität und Quantität landwirtschaftlicher Produkte hat wesentlich zum Wohlstand beigetragen“, sagt Wöckinger. Dieser mache aber auch kritischer, was Herkunft, Zusammensetzung oder Preis der Lebensmittel angehe. „Es ist grundsätzlich gut, wenn sich Konsumenten konstruktiv mit Lebensmitteln auseinandersetzen, jedoch gehört das mit zu den Kostentreibern“, sagt Wöckinger. „Die Landwirte sind bereit, den Wünschen der Konsumenten zu entsprechen, sofern es auch bezahlt wird.“
Der Auszahlungspreis der Milch hängt an mehreren Parametern. Dazu gehören zum einen der Fett- und Eiweißanteil der Milch, zum anderen die Zell- und Keimzahl. Die Zellzahl ist ein Hinweis auf die Eutergesundheit der Kühe, die Keimzahl auf den Hygienestandard. „Die Mengen und Parameter werden genau erfasst und im darauffolgenden Monat bekommen die Bauern und Bäuerinnen dann ihr Geld.“ Die Molkerei verhandelt je nach vorhandenem Produktsortiment mit dem Lebensmittelhandel und anderen Abnehmern.
Milchpreis zu niedrig
Die Milchbauern und -bäuerinnen sind größtenteils Eigentümer/innen der Molkerei. „Entscheidungen werden von den gewählten bäuerlichen Vertretern im Vorstand getroffen. Ziel ist die Unterstützung der Mitglieder in Form des bestmöglichen Milchpreises“, erklärt Wöckinger.
Aktuell haben Milchbetriebe und Molkereien mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Zudem hätten die aktuellen Teuerungen Auswirkungen auf die Nachfrage: „Der Konsument spart meist zuerst bei Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs und greift zu billigeren Alternativen“, sagt Wöckinger. Bei Eigenmarken des Handels, vor allem jenen im niedrigen Preissegment, sei unbedingt auf die Herkunft zu achten: „Der Griff zu heimischen Markenartikeln ist ein wichtiger Beitrag für die Aufrechterhaltung der heimischen Qualitätsmilcherzeugung. Dafür bedanken wir uns bei allen, die diese bewusste Kaufentscheidung treffen, bei den Konsument/innen ebenso wie bei Gastronomiebetrieben und Großküchen.“
Wert der Lebensmittel
Kritisch sieht Wöckinger die um sich greifende „Aktionitis“ (z. B. „Nimm zwei zahl eins“), die die Lebensmittelverschwendung begünstige. „Wir müssen überlegen, was uns Lebensmittel wirklich wert sind. Die Bauern wollen eine gewisse Wertschätzung für ihre Arbeit haben. Das drückt sich eben auch im Preis aus. Die Landwirte sind Hersteller hochwertiger Lebensmittel, Landschafts- und Kulturpfleger. Sie sichern die Ernährung der Menschen und dazu noch viele Arbeitsplätze.“ «
Milchwirtschaft im Fokus
Teil 3 von 3

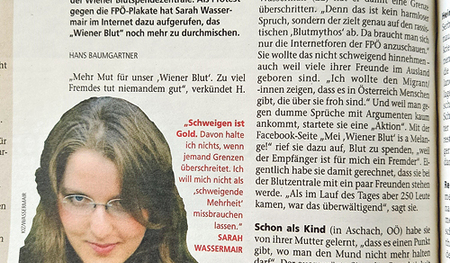



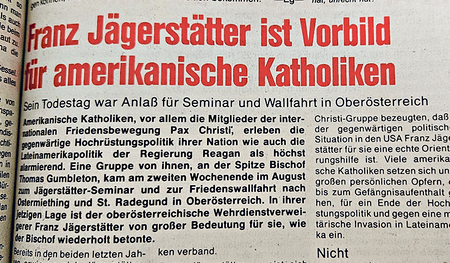

 Jetzt die
Jetzt die