
Lösung in Sicht

Wer Dinge in der Ferne oder Nähe nicht scharf sieht, braucht eine Brille oder Kontaktlinsen. In Österreich ist das eine häufige und meist unkomplizierte Sache. Nicht so in Uganda. Im staatlichen Gesundheitssystem, das allen zugänglich ist, gibt es kaum Augenspezialist/innen. Den Besuch einer privaten Augenordination können sich die wenigsten leisten.
Ein paar Bäume, die Schatten spenden. Darunter sitzen die jungen Männer eines kleinen Dorfs in Westuganda, 300 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt. Während sie Witze machen und Neuigkeiten austauschen, versucht sich einer von ihnen auf die Vorlesung zu konzentrieren.
Benjamin hatte sein erstes Studienjahr der Optometrie an der Makerere-Universität in Kampala abgeschlossen, als ihn die Corona-Pandemie in sein Heimatdorf zurückführte. Mit seinem Tablet machte er sich dort auf die Suche nach der bestmöglichen Internetverbindung, denn in seinem Elternhaus spielten die mobilen Daten Stop-and-go, es gab ständig Unterbrechungen. So konnte er den Online-Vorlesungen nicht folgen. Doch hundert Meter unterhalb, im Schatten der Bäume, reichte die Empfangsqualität aus.
Erfahrung sammeln
Zwei Semester lang widmete er sich hier als einziger seines Dorfs dem Studium, hochmotiviert. „Das Problem war, dass wir in dieser Zeit keine praktischen Übungen hatten“, erinnert er sich. „Wenn man nur die Theorie hört, wie eine bestimmte Sehstörung zu erkennen ist, aber nicht weiß, wie es aussieht, kann man sich schwer etwas darunter vorstellen.“
Umso glücklicher war er, als der Unibetrieb endlich wieder losging und er die Praktika der letzten Semester nachholen konnte. Die Studierenden untersuchen die Augen ihrer Kollegen und Kolleginnen mit optometrischen Geräten, wie sie auch in Europa verwendet werden. Optometrie ist ein universitäres Studium der Augenoptik. Wer es absolviert hat, ist nicht Augenarzt oder Augenärztin, sondern Master der Augenoptik, spezialisiert auf die Korrektur von Fehlsichtigkeit, nicht auf Augenkrankheiten.
Expert/innen fehlen
Uganda hat 45 Millionen Einwohner/innen, aber kaum Augenspezialist/innen. Bis vor wenigen Jahren konnte man Optometrie nur im Ausland studieren. Wer mit fertiger Ausbildung zurückkam, eröffnete eine Augenordination für wohlhabende Privatpatient/innen.
Die meisten Menschen sind aber auf das staatliche Gesundheitssystem angewiesen. Die Untersuchungen und Behandlungen der staatlichen Spitäler, Ambulanzen und Ordinationen stehen kostenfrei zur Verfügung – doch gibt es viel zu wenige davon.
Schmerzen ohne Erklärung
Sheilla Mugerwa kann ein Lied davon singen. Sie hatte Glück, weil sie von ihren Eltern mit 12 Jahren auf das Mädcheninternat in Iganga geschickt wurde. Die Schule hat einen guten Ruf, die meisten Absolventinnen gehen weiter an die Uni. Doch Sheilla kämpfte Tag für Tag: „Ich musste mich so anstrengen, um von der Tafel lesen zu können! Jeden Abend schmerzten meine Augen. Einmal schlief ich sogar in der Klasse ein vor Anstrengung.“
Außerdem fiel es ihr schwer, Anschluss zu finden. Sie erkannte ihre Freundinnen am Schulhof nicht von weitem, sodass diese sauer auf sie waren. Erst durch das Programm „One, two, three – I can see!“ („Eins, zwei, drei – ich kann sehen!”) fand sie den Grund ihrer Probleme heraus: Kurzsichtigkeit.
Schule hilft sehen
Das Programm bildet Lehrpersonen darin aus, Sehschwäche bei Schulkindern zu erkennen. Dadurch werden auf relativ einfache Weise Sehstörungen bei Kindern gefunden, die sonst unentdeckt blieben. Das nächste Problem: Auch Brillen sind für den Großteil der Menschen in Uganda unleistbar.
Die Hilfsorganisation „Licht für die Welt“, die in Zusammenarbeit mit dem ugandischen Gesundheitsministerium das Programm „One, two, three – I can see!“ in Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen in Uganda einführt, eröffnete vor 12 Jahren auch eine kleine Brillenproduktionsstätte.
Zwei gelernte Optiker schleifen dort Brillengläser mithilfe gespendeter Geräte, damit sie die richtige Stärke für die fehlsichtigen Jugendlichen haben. Vor wenigen Wochen bekam Sheilla ihre erste Brille. „Ich war so glücklich, als ich damit zum ersten Mal in den Spiegel schaute!“, lächelt sie und erzählt, dass sie nun auch ihre Freundinnen von Ferne grüßen kann. Bei den 1.815 Internatsschülerinnen in Iganga ist das keine leichte Übung. «






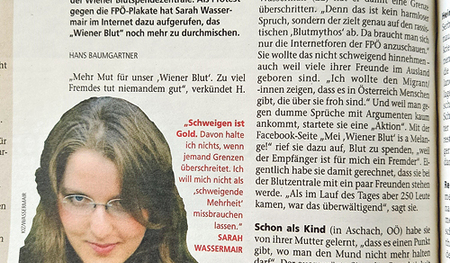



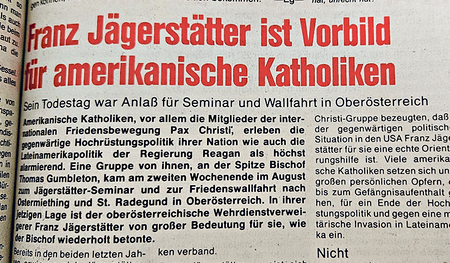

 Jetzt die
Jetzt die