
Der Spionagefall Margarethe Ottillinger

Margarethe Ottillinger kam mit einem der letzten Heimkehrertransporte aus der Sowjetunion am 25. Juni 1955 auf einer Tragbahre liegend und schwer gezeichnet von sieben Jahren Gulag-Zwangsarbeitslager in Wiener Neustadt an. Das Bild ging durch alle Medien, denn die Hintergründe ihrer Verhaftung 1948 an der Ennsbrücke waren immer noch Schlagzeilen wert.
Beginn der Karriere
Als exzellente Wirtschaftsexpertin fiel die junge Doktorin dem damaligen Präsidenten der Bundeswirtschaftskammer, Julius Raab, auf. Er suchte jemanden, der Schwung in die etwas lahme Bürokratie des für den wirtschaftlichen Wiederaufbau wichtigen Bundesministeriums für Wirtschaftsplanung und Vermögenssicherung brachte. Ottillinger wurde 1946 mit 27 Jahren zur Leiterin der Sektion III/Wirtschaftsplanung bestellt. Nicht zur Freude der etablierten Beamtenschaft.
Ihrer Energie war es zu verdanken, dass innerhalb kürzester Zeit die für die Inanspruchnahme der Marshallplanhilfe notwendigen Energie-, Kohlen- und Eisenpläne fertiggestellt wurden und Österreich nach Norwegen die zweithöchste Pro-Kopf-Zuweisung bekam. Ins Visier der Sowjets geriet Ottillinger, als sie für die kommenden Staatsvertragsverhandlungen den Wert des von den Sowjets beschlagnahmten deutschen Eigentums in Österreich herausfinden sollte.
Die ehrgeizige junge Frau erkannte nicht, in welche gefährliche Situation sie dadurch geriet – auch durch ihre engen Beziehungen zu ihrem Chef, Minister Peter Krauland, dessen Doppelspiel nie ganz geklärt wurde. So machte er sie mit einem Adjutanten des US-Hochkommissars bekannt, der in Wirklichkeit ein ranghoher amerikanischer Geheimdienstoffizier war; und ebenso mit einem russischen Stahlexperten, der sich später in den Westen absetzte. Im berüchtigten sowjetischen Zentralgefängnis in Baden bei Wien begriff sie erst, in welche Falle sie geraten war.
Warnschuss für wen?
Es war der 5. November 1948, als Margarethe Ottillinger und Peter Krauland nach einem Termin in Linz im Auto Ottillingers nach Wien fuhren, da das Dienstauto des Ministers angeblich einen Defekt hatte. Anstandslos passierten sie die amerikanische Kontrolle an der Ennsbrücke und näherten sich dem russischen Kontrollposten. Sie wurden sofort von Soldaten umzingelt und zur Weiterfahrt in die Kommandantur St. Valentin gezwungen. Dann passierte das Merkwürdige – Minister Krauland und dem Chauffeur wurde nach nur 15 Minuten die Weiterfahrt nach Wien erlaubt. Zurück blieb Margarethe Ottillinger, die noch in der gleichen Nacht nach Baden gebracht wurde.
Man bezichtigte sie der Spionage für Amerika und der Fluchthilfe, was sie vehement bestritt. Zwei Monate lang musste sie nächtelange Verhöre, Stehkarzer – stundenlanges Stehen, ohne sich setzen zu dürfen –, Waschverbot und Schlafentzug über sich ergehen lassen. Am 13. Mai 1949 erhielt sie das Urteil: 25 Jahre Arbeitslager, „einsetzbar für jede Arbeit“. In einem Viehwaggon ging die Fahrt in den Osten, in das Sonderlager Dubrawlag.
Der Protest der österreichischen Bundesregierung fiel sehr schaumgebremst aus, denn man wollte die laufenden Staatsvertragsverhandlungen nicht gefährden. Gemunkelt wurde, dass die Verhaftung Ottillingers eigentlich ein Warnschuss für Peter Krauland mit seinem vermuteten Doppelspiel zwischen amerikanischen und sowjetischen Geheimdiensten sei. Die Verhaftung eines Ministers hätte zu viel Aufsehen erregt. Ein Warnschuss war dagegen die seiner engsten Mitarbeiterin. Margarethe Ottillinger wurde 1956 seitens der UdSSR rehabilitiert und das Urteil aufgehoben.
Der einzige Mann – eine Frau
Nach ihrer Rückkehr und Monaten der Rekonvaleszenz versuchte Margarethe Ottillinger den Einstieg in das Berufsleben. Wieder war es Julius Raab, nunmehr Bundeskanzler, der ihr ein Angebot machte. Aus der von den Russen beschlagnahmt gewesenen Erdölindustrie sollte wieder ein österreichisches Unternehmen werden. Margarethe Ottillinger gelang nicht nur dies, sondern sie machte als erste Vorstandsdirektorin die ÖMV auch international wettbewerbsfähig. Bald kursierte der Satz: Der einzige Mann in der ÖMV ist eine Frau.
Tiefgläubig
Margarethe Ottillinger blieb auch in ihrem zweiten Leben umtriebig. Als Meisterin im Geldaufbringen war sie wesentlich am Aufbau verschiedener kirchlicher Einrichtungen beteiligt wie dem Afro-Asiatischen Institut (AAI) oder Pro Oriente. Ihr größtes Anliegen war die von dem Bildhauer Fritz Wotruba erbaute Kirche am Georgenberg in Wien.
Ein guter Kontakt entstand auch zum Erzbischof von Wien, Kardinal Franz König, der sich in Fragen der kirchlichen Ostpolitik oft von ihr beraten ließ. Wesentlich trug sie auch zur Aufnahme der Beziehungen zwischen Kirche und Sozialdemokratie bei.
Trotz ihrer beruflichen Position und den damit verbundenen vielfältigen Begegnungen blieb Margarethe Ottillinger ein einsamer Mensch. Vielleicht lag es an ihrer beherrschenden, oft besitzergreifenden Art oder ihrer Energie, mit der sie ihr Gegenüber oft verunsicherte. Eine Heimat fand sie in den letzten Jahren noch im Kloster der Schwestern Servitinnen in Wien-Mauer, in deren dritten Orden sie knapp vor ihrem Tod eintrat. Margarethe Ottillinger starb am 30. November 1992.
Ingeborg Schödl ist Autorin der Biographie „Im Fadenkreuz der Macht. Das außergewöhnliche Leben der Margarethe Ottillinger“ , Czernin-Verlag (2. Neuauflage 2015).

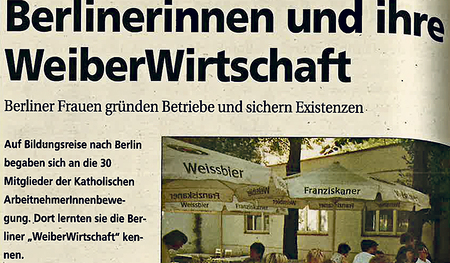





 Jetzt die
Jetzt die