BRIEF_KASTEN
Das Spital als Schicksals-Mühle
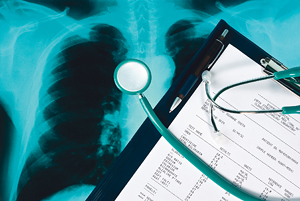
© pabijan - Fotolia
Ob Knochenbruch, Blinddarmoperation oder Krebsbefund – unabhängig von der Schwere der Erkrankung stellt jede Einlieferung in ein Spital die Gefühlswelt der Betroffenen völlig auf den Kopf. Denn im Krankenhaus werden die Patienten unausweichlich mit der Tatsache konfrontiert, dass das Leben zerbrechlich und endlich ist.
Als „Schicksalsmühle“, in die die Patienten geraten, bezeichnet Birgit Langebartels das Krankenhaus: Stillgelegt und in einem fremden Getriebe mit schwer nachvollziehbaren Regeln, erleben die Kranken eine völlige Gegenwelt zu draußen. Die Psychologin hat in einer Studie (in Deutschland) die Erfahrungen von Patienten/innen, Ärzt/innen und Pflegekräften untersucht. Dabei zeigt sich, dass ein Klinikaufenthalt bei Patient/innen nicht nur eine Krise auslöst, sondern auch heilsam sein kann. Die Tage in einem Spital führen in den allermeisten Fällen nicht nur zur körperlichen Genesung, sie tun oft auch der seelischen Gesundheit gut: Wenn es dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt, betont Langebartels.
Wie ein Spitalsaufenthalt erlebt wird, entscheidet sich häufig schon bei der Aufnahme. Die erste Begegnung darf nicht zu einem Verwaltungsakt verkommen, sondern der Patient möchte einen Ansprechpartner erleben, der ihn persönlich in das kommende Unbekannte einführt und ihm Vertrauen gibt: „Der Kranke möchte vom Fall zum Menschen werden, erst dann kann er sich fallen lassen und wird fähig, bei der Genesung zu kooperieren.“ Langebartels Erhebungen in deutschen Kliniken zeigen, dass bei der Aufnahme erheblicher Handlungsbedarf besteht: „Die Zeit, die man hier investiert, würde vielfach zurückkommen.“
Da der Krankenhausaufenthalt von den alltäglichen Pflichten wie Arbeit, Kochen und Staubsaugen und auch vom Joggen entbindet, ist der Patient plötzlich mit viel freier Zeit konfrontiert. Natürlich wird sie durch die Behandlungen eingeschränkt und ungeplante Wartezeiten stehen im Krankenhaus auf der Tagesordnung, aber trotz allem entsteht durch die fixen Essenszeiten und die festgelegten Abläufe von Pflege, Untersuchungen und Ruhezeiten ein strukturierter Tagesblauf. Das erinnert an ein Kloster – unabhängig, ob es sich um ein Ordensspital oder ein öffentliches Krankenhaus handelt.
Eine solche klösterliche Atmosphäre kann sehr heilsam sein, erklärt die Psychologin. Aber auch hier ist das erklärende Gespräch wichtig, damit sich die Patienten in dieser unvermittelt über sie hereingebrochenen Tagesstruktur orientieren können und Tipps bekommen, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Broschüren mit Texten, die ihre Lebenssituation deuten, haben hier ihren Platz.
Langebartels fordert gegenüber den Patienten auch eine klare, bildhafte Sprache. Anstatt eine Lithotripsie durchzuführen, kann man ganz einfach sagen: Ihre Gallensteine werden zerschossen. Wie die Aufnahme ist auch die Entlassung ein Knackpunkt.
Ein Verabschiedungsritual könnte hilfreich sein, sagt sie aus der Perspektive einer Psychologin. „Leider kenne ich in Deutschland kein Krankenkaus, an dem ein solches praktiziert wird.“
Als Bilanz ihrer Studie hält sie fest: Das Spital ist für die Menschen eine Schicksals-Mühle, sie werden darin aber nicht zermahlen. Überraschend viele erleben den Aufenthalt als eine Erweiterung ihrer Lebensperspektiven.
Als „Schicksalsmühle“, in die die Patienten geraten, bezeichnet Birgit Langebartels das Krankenhaus: Stillgelegt und in einem fremden Getriebe mit schwer nachvollziehbaren Regeln, erleben die Kranken eine völlige Gegenwelt zu draußen. Die Psychologin hat in einer Studie (in Deutschland) die Erfahrungen von Patienten/innen, Ärzt/innen und Pflegekräften untersucht. Dabei zeigt sich, dass ein Klinikaufenthalt bei Patient/innen nicht nur eine Krise auslöst, sondern auch heilsam sein kann. Die Tage in einem Spital führen in den allermeisten Fällen nicht nur zur körperlichen Genesung, sie tun oft auch der seelischen Gesundheit gut: Wenn es dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt, betont Langebartels.
Knackpunkt „Aufnahme“
Wie ein Spitalsaufenthalt erlebt wird, entscheidet sich häufig schon bei der Aufnahme. Die erste Begegnung darf nicht zu einem Verwaltungsakt verkommen, sondern der Patient möchte einen Ansprechpartner erleben, der ihn persönlich in das kommende Unbekannte einführt und ihm Vertrauen gibt: „Der Kranke möchte vom Fall zum Menschen werden, erst dann kann er sich fallen lassen und wird fähig, bei der Genesung zu kooperieren.“ Langebartels Erhebungen in deutschen Kliniken zeigen, dass bei der Aufnahme erheblicher Handlungsbedarf besteht: „Die Zeit, die man hier investiert, würde vielfach zurückkommen.“
Das Spital wird zum Kloster auf Zeit
Da der Krankenhausaufenthalt von den alltäglichen Pflichten wie Arbeit, Kochen und Staubsaugen und auch vom Joggen entbindet, ist der Patient plötzlich mit viel freier Zeit konfrontiert. Natürlich wird sie durch die Behandlungen eingeschränkt und ungeplante Wartezeiten stehen im Krankenhaus auf der Tagesordnung, aber trotz allem entsteht durch die fixen Essenszeiten und die festgelegten Abläufe von Pflege, Untersuchungen und Ruhezeiten ein strukturierter Tagesblauf. Das erinnert an ein Kloster – unabhängig, ob es sich um ein Ordensspital oder ein öffentliches Krankenhaus handelt.
Eine solche klösterliche Atmosphäre kann sehr heilsam sein, erklärt die Psychologin. Aber auch hier ist das erklärende Gespräch wichtig, damit sich die Patienten in dieser unvermittelt über sie hereingebrochenen Tagesstruktur orientieren können und Tipps bekommen, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Broschüren mit Texten, die ihre Lebenssituation deuten, haben hier ihren Platz.
Lebensperspektiven durch Krankheit
Langebartels fordert gegenüber den Patienten auch eine klare, bildhafte Sprache. Anstatt eine Lithotripsie durchzuführen, kann man ganz einfach sagen: Ihre Gallensteine werden zerschossen. Wie die Aufnahme ist auch die Entlassung ein Knackpunkt.
Ein Verabschiedungsritual könnte hilfreich sein, sagt sie aus der Perspektive einer Psychologin. „Leider kenne ich in Deutschland kein Krankenkaus, an dem ein solches praktiziert wird.“
Als Bilanz ihrer Studie hält sie fest: Das Spital ist für die Menschen eine Schicksals-Mühle, sie werden darin aber nicht zermahlen. Überraschend viele erleben den Aufenthalt als eine Erweiterung ihrer Lebensperspektiven.






 Jetzt die
Jetzt die