Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Das Verfassungsgericht hat das ausnahmslose Verbot der Suizidbeihilfe am Lebensende zum Anlass genommen, einen Teil der Strafbestimmung „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78 StGB) als verfassungswidrig aufzuheben. Damit ist ab 1. Jänner 2022, wenn der Gesetzgeber keine Neuregelung schafft, nur mehr strafbar, wer bei einem anderen den Willen zur Selbsttötungshandlung weckt. Wer ihn bloß dabei unterstützt, indem er ihm etwa tödliche Medikamente besorgt oder ihn in eine Sterbeklinik ins Ausland begleitet, handelt straffrei. Die strafbare Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) bleibt unangetastet.
Es geht also in der nunmehrigen Diskussion nicht um eine Liberalisierung der „Sterbehilfe“, weil für die Tötung durch fremde Hand keine Änderungen angedacht sind. Nur für die schlichte Unterstützung bei der Selbsttötung muss sich der Gesetzgeber überlegen, ob er eine Neuregelung im Bereich des Strafrechts will. Das zentrale Argument des Verfassungsgerichts für seine Entscheidung ist das Recht des Menschen auf Selbstbestimmung, das auch sein Recht umfasst, aus dem Leben zu scheiden. Das ausnahmslose Verbot der Unterstützung bei einem solchen Vorhaben stehe dem entgegen und berge überdies die Gefahr für ein menschenunwürdiges Sterben, wenn Sterbewillige etwa kein todbringendes Medikament erhalten können und daher eine grausame Form der Selbsttötung wählen müssen. Eine Lockerung des Verbots könne sogar zu einer Lebensverlängerung führen, weil Sterbewillige nicht vorzeitig, solange sie noch ausreichend mobil sind, in die Schweiz fahren müssen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt auch in Österreich Hilfe erhalten können. Hier wurde auch die Pflicht von Staat und Gesellschaft betont, für den Ausbau der Palliativmedizin zu sorgen, damit Menschen in der Selbsttötung keinen letzten Ausweg sehen.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts verdient insgesamt Zustimmung. Sie spielt den Ball dem Gesetzgeber und damit dem „Volk“ zu. Möglich wäre eine weniger strenge Neuregelung, die nicht jede Unterstützung bei der Selbsttötung verbietet, oder auch der Verzicht auf eine strafrechtliche Regelung und stattdessen ein verstärktes Bemühen zur Selbstmordprävention. Da das Strafrecht nur die gravierendsten Verstöße gegen den gesellschaftlichen Wertekonsens unter Strafe stellen darf, verdient der Verzicht auf eine neue Strafbestimmung den Vorzug, zumal die Einstellung in der Bevölkerung zu diesem Thema uneinheitlich ist. Die gutgemeinte Unterstützung beim selbstbestimmten Sterben wird durch kein Verbot verhindert werden. Umgekehrt bringt eine Kriminalisierung solcher Unterstützung großes Leid über Angehörige, die einen lieben Menschen bei diesem letzten Schritt nicht alleine lassen. Wer dem Sterbewilligen dabei unterstützend die Hand hält, musste sich bisher vor dem Strafrichter verantworten, weil er den Selbstmord nicht verhindert hat. Gleiches galt für Ärzt/innen, die dem Sterbewilligen das todbringende Medikament zur Selbsteinnahme überlassen hatten.
Ziel der durch die höchstgerichtliche Entscheidung angestoßenen Diskussion sollte es nun sein, den Schutz verwundbarer Personen durch andere Maßnahmen zu erreichen. Eine neue Strafbestimmung würde keinen Cent für den Ausbau der Palliativmedizin garantieren. Sie wäre eine Lösung zu Lasten der Selbstbestimmtheit des Menschen. Der Weg sollte in eine andere Richtung gehen. «
Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs stellt den Nationalrat vor eine kaum lösbare Aufgabe: Zwar wurden das Verbot der Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) und das Verbot der Verleitung zum Suizid (§ 78 Alternative 1 StGB) als verfassungskonform bestätigt. Doch das Verbot der Beihilfe zum Suizid (§ 78 Alternative 2 StGB) wurde aufgehoben. Ein ausnahmsloses Verbot widerspreche der Verfassung. Denn das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in Artikel 8 der Europäischen Menschrechtskonvention beinhalte das Recht, Art und Zeitpunkt des Todes frei zu bestimmen. Damit dieses Recht auch in schwerer Krankheit in Anspruch genommen werden könne, müsse es das Recht umfassen, dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die einzige Bedingung sei, dass es sich um eine erkennbar freie und selbstbestimmte Entscheidung handle.
Aus ethischer Sicht werden damit die individuellen Freiheitsrechte im Vergleich zu den sozialen Pflichten überbewertet. Jeder Mensch hat Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen, und die kommt in den Erwägungen des Gerichts nicht vor. Es erkennt zwar an, dass das Leben grundsätzlich lebenswert ist, und lädt den Gesetzgeber ausdrücklich ein, die straffreie Suizidbeihilfe eng zu begrenzen. Die Frage ist allerdings, ob dies möglich ist. Denn das Erkenntnis macht die straffreie Suizidbeihilfe ausdrücklich nicht von einer schweren Krankheit im Endstadium abhängig. Auch gesunde Menschen müssen Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen können, solange sie nur unbeeinflusst von Dritten und im Vollbesitz ihrer Urteilsfähigkeit entscheiden. Damit sind wir weit entfernt vom Fall eines Menschen, der unter unerträglichen, nicht linderbaren Schmerzen leidet.
Was also soll der Gesetzgeber tun? Natürlich sollte er die vom Verfassungsgerichtshof angegebenen Bedingungen einer möglichst strengen Kontrolle unterwerfen. Eine geeignete Kommission aus mehreren dafür kompetenten Personen sollte prüfen, ob ein Mensch, der um Suizidbeihilfe ersucht, wirklich frei von äußeren Einflüssen, auf der Grundlage bestmöglicher Information und im Vollbesitz seiner geistigen Urteilsfähigkeit entscheidet.
Dennoch ist mit einem hohen Zahl assistierter Suizide zu rechnen. Denn in allen Ländern, die schon länger eine streng regulierte Straffreistellung der Suizidbeihilfe haben, geht diese Zahl ungebremst nach oben. Im US-Bundesstaat Oregon machten die assistierten Suizide 1998 0,08 Prozent aller Todesfälle aus. 2008 waren es 0,19 Prozent und nochmals zehn Jahre später 0,49 Prozent. Im Jahr 2020 lag die Quote bei 0,66 Prozent. Der Nachbarbundesstaat Washington weist fast exakt dieselben Zahlen auf. Die Kurve steigt also immer schneller immer steiler an – und ein Ende ist nicht in Sicht. Noch weiter fortgeschritten ist die Entwicklung in der Schweiz: Waren die assistierten Suizide 2003 etwa 0,3 Prozent aller Todesfälle, lag die Quote 2013 bei 0,79 Prozent und 2018 bei 1,75 Prozent. Seit 2017 ist die Zahl assistierter Suizide höher als die Zahl herkömmlicher Suizide, die jedoch ihrerseits nicht sinkt. Insgesamt steigt also in jenen Ländern, die schon länger eine streng begrenzte Straffreistellung der Suizidbeihilfe haben, die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit explosiv und bislang ungebremst an. Keines dieser Länder hat einen Weg gefunden, diesem Anstieg Einhalt zu gebieten. Das stimmt wenig optimistisch mit Blick auf eine österreichische Regelung. «
Berichterstattung über das Thema Suizid findet stets auf dem schmalen Grat zwischen Informations- und Schutzpflicht statt. Klar muss sein, dass es Hilfseinrichtungen gibt, die professionelle Hilfe anbieten. Bei Sorgen wenden Sie sich daher bitte an die Telefonseelsorge unter 142.

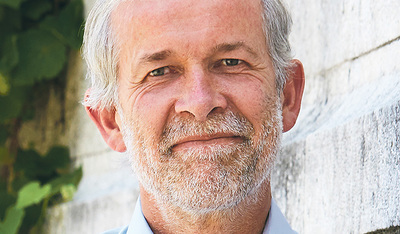
Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.
Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>
 Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>