
Reihe um Reihe zur Ernte

Afrika ist global gesehen nur für vier Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig befinden sich dort jene Länder, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.
„Afrika ist deshalb so verwundbar, weil mehr als 80 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt sind. Die Landwirtschaft ist das Rückgrat der afrikanischen Wirtschaft. Industrie gibt es keine“, sagt Ambrose Osakwe. Der gebürtige Nigerianer betreut als Landwirtschaftsexperte Projekte der Caritas Österreich in der Demokratischen Republik Kongo und in Burundi.
Ausgedehnte Trockenzeit
Die Auswirkungen der Klimakrise sind hier schon seit Jahren spürbar, sagt der Experte: „Die Temperaturen sind massiv gestiegen, die Trockenzeit dehnt sich aus, die Bauern und Bäuerinnen wissen nicht mehr, wann sie ihre Feldfrüchte anbauen können. Der Regen kommt unregelmäßig, zu spät oder gar nicht. Die Bauern und Bäuerinnen sind aber abhängig von den Niederschlägen, da Möglichkeiten für eine alternative Bewässerung fehlen. Das führt zu Ernteverlusten und damit auch zur Unterernährung der Menschen.“
In der traditionellen Landwirtschaft, die als Wanderfeldbau betrieben wird, sei etwa der Ertrag von Erdnüssen von 1500 Kilogramm pro Hektar auf 700 Kilogramm und beim Reis von 2000 Kilogramm auf durchschnittlich 850 Kilogramm gesunken. Nicht zuletzt werde der Klimawandel einem Bericht der Weltbank zufolge zahlreiche Menschen zur Migration innerhalb ihres Landes zwingen.
Klimafitter Ackerbau
Um die Auswirkungen des Klimawandels in der Demokratischen Republik Kongo abzumildern, setzt die Caritas OÖ mit ihrem Projekt in der Region Luozi auf Agroforstwirtschaft und Maßnahmen zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Konkret wird die Anbaumethode „Alley Cropping“ (= bebaute Gassen) angewendet: „Hier werden Baum- oder Buschreihen abwechselnd zwischen Reihen von Feldfrüchten oder Futterpflanzen gesetzt“, erklärt Ambrose Osakwe, zum Beispiel Akazien und dazwischen Hülsenfrüchte wie Bohnen.
„Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Bewirtschaftungszeit des Felds verlängert wird und sich der Boden während der Brachzeit schneller erholt. Die Bäume holen durch ihre tiefer wachsenden Wurzeln Nährstoffe, die normalerweise verloren gegangen wären, nach oben, sodass sie den anderen Pflanzen zur Verfügung stehen.“ Außerdem wirken die Bäume als Windschutz und deren Holz kann später als Brennstoff verwendet werden. Die Mischkulturen würden anders als Monokulturen zudem Ausfälle ausgleichen können.
Unabhängigkeit
Die klimawandelangepasste Anbauweise sichere zum einen die Ernährung der Kleinbäuerinnen (oft sind es Frauen, die die Felder bewirtschaften) es ermögliche ihnen andererseits auch ein Einkommen. „Sie können nicht nur für den Eigenbedarf anbauen, sondern einen Teil ihrer Ernte auch auf dem Markt verkaufen“, sagt Ambrose Osakwe.
Die Caritas schult die Kleinbauern und -bäuerinnen nicht nur im Ackerbau, sondern auch in der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten (z. B. Trocknung von Maniok, Süßkartoffeln, Mais, Bananen usw.), der Imkerei, Pilzzucht oder auch der Herstellung von Backwaren. Ziel ist, dass die Menschen unabhängiger werden und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können.
Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit der Caritas OÖ, die für das Projekt Spenden sammelt.
Infos: www.caritas-ooe.at






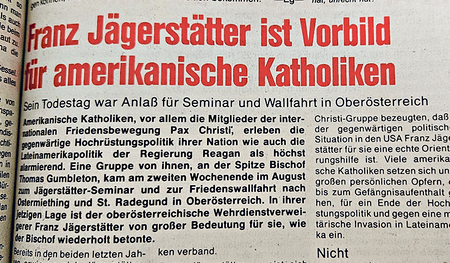



 Jetzt die
Jetzt die