
Kinder vor Gewalt im Netz schützen

Silke Müller, Direktorin an der Oberschule im deutschen Hatten, warnt und klärt auf vor den Gefahren, die damit verbunden sind.
Manche Inhalte, die im Netz, auf dem Smartphones die Runde machen, sind oft keine leichte Kost, schon gar nicht für Schüler:innen. Was ist da in den Klassen im Umlauf?
Silke Müller: Das sind auf Plattformen wie TikTok, Twitter oder twich zur Verfügung gestellte grausame Videos und Fotos von Personen, die die Schüler:innen gar nicht kennen. Da geht es um bestialischste Tierquälerei, um Rassismus, um Folter, um Hinrichtungs-Videos, man sieht Mordszenen und Kriegsverbrechen, man sieht perverseste Pornografie, die mit normaler Sexualität nichts zu tun hat. Häufig wird gesagt, Pornografie und Prostitution als das älteste Gewerbe der Welt gab es immer. Doch dass bereits Kinder so leicht Zugang zu gewaltverherrlichenden Abgründen haben, wo sich Menschen gegenseitig brutal erniedrigen, war nicht immer so. Das ist besorgniserregend.
Wie oft kommt es vor, dass Sie an der Schule mit solchem Material konfrontiert werden?
Müller: Fast täglich. Das Verschicken von Bildern, Videos und Stickern mit verstörenden Inhalten ist schon Alltag auf den Smartphones von Jugendlichen und Kindern geworden. Immer wieder geht es dabei auch um strafrechtlich relevante Inhalte. Wenn diese Fälle passieren, sind das in der Regel jene Kinder, die sehr gut geschult sind. An unserer Schule finden regelmäßig Seminare mit Rechtsanwälten und Medienpädagogen statt. Die jungen Leute wissen genau, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was Gefahren im Netz sind – und handeln anders. Jeden Tag was Neues. Leider.
Spielt auch Mobbing eine Rolle?
Müller: Ja – da werden Kinder selber zu Tätern und nutzen das Netz, um andere fertig zu machen, bloßzustellen, zu erpressen. Dass Menschen übereinander schimpfen gab es zwar auch schon immer, aber die Art und Weise, jemanden zu demütigen und bewusst in eine Lage zu treiben, die nicht aushaltbar ist, geht darüber hinaus. Wir hatten gerade einen Fall: Ein Mädchen und ein Junge gaben vor, verliebt zu sein, sie schrieben im Netz in sexualisierter Sprache hin und her. Das Mädchen forderte den Jungen auf, ein Nacktfoto von ihm zu senden, was er tat. Dieses Foto verschickte sie weiter, zeigte es den Mitschülerinnen und Mitschülern und sagte, „guck mal, wie behaart der ist.“ Wenn wir Lehrende das mitbekommen, ist es oft schon zu spät und dieser junge Mensch muss das dann aushalten.
Eine weitere Gefahr für Kinder und Jugendliche ist, wenn sie über Plattformen im Netz von Pädophilen angesprochen werden und sexuelle Gewalt erfahren. Vor all diesen Abgründen im Netz dürfen wir nicht die Augen verschließen, denn sonst bleibt das ein völlig unbegleiteter Raum, wo Kinder keine Hilfe und keinen Schutz finden. Übrigens wir Erwachsenen auch nicht. Im Gegensatz zu Kindern sind wir aber für uns selber verantwortlich und oft die schlechtesten Vorbilder.
Was tun Sie zum Schutz an Ihrer Schule?
Müller: Generell ist mein Wunsch, kein Smartphone vor 16. Das ist natürlich illusorisch. Aus Erfahrung weiß ich, dass die meisten Probleme mit Kindern nicht durch Verbote, Sanktionen und Gebote gelöst werden, sondern im Gespräch, wo sie offen über alles reden können. Deshalb haben wir an der Schule eine Social-media-Sprechstunde ins Leben gerufen, wo die Kinder hingehen und sagen können, ich habe da etwas gesehen, das ist total schwierig für mich zu verarbeiten oder mir ist etwas passiert oder ich habe etwas gemacht. Das geschieht erst mal unter dem Duktus der Vertraulichkeit. Dann wird überlegt, was ist der Weg aus dieser Situation. Was wir Lehrende auch machen: Wir gehen in die Welt der Kinder rein, um aus ihren Augen zu schauen.
Um zu sehen, was tatsächlich vor sich geht ...
Müller: Genau. Wir haben mehrere Accounts angelegt bei sozialen Netzwerken, die bei den Kindern aktuell sind, und haben uns z. B. bei TikTok so angemeldet als wären wir ein Junge, ein Mädchen, der oder die könnte 13 Jahre alt sein, um zu wissen, was die sehen würden. Das heißt, die Eigenrecherche spielt eine große Rolle. Die gehört meiner Meinung nach in jede Schule, in jedes Elternhaus, weil wir uns als Lehrende und Eltern, auch als Großeltern, mit der Lebenswelt der Kinder beschäftigen müssen. Kinder gehen ja bei Problemen oft erst einmal zu Oma und Opa. Und wenn die dann sagen, pass auf, du zeigst mir das mal und ich gebe dir einen Tipp aus meiner Sicht, kann das für Kinder eine große Hilfe sein.
Man muss Bewusstsein dafür schaffen ...
Müller: Ja, auch Betroffenheit, um zu verstehen, dass die verstörenden Inhalte eine Gefährdung sind für die Psyche, aber im weiteren Sinne auch für Demokratie, Gemeinwohl und Friedfertigkeit, weil Kinder ja auch erleben, dass sie fertig gemacht werden im Netz, wenn sie sich solidarisch für jemanden einsetzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einander aufrütteln, darüber ins Gespräch kommen – da ist übrigens auch die Politik und die Zivilgesellschaft gefordert. Wir müssen uns die Kinder zurückholen auf Basis einer ethischen, moralischen und wertebasierten Medienerziehung.
NICHT IM STICH LASSEN
Wie in Deutschland, nehmen auch in Österreich gewaltverherrlichende Inhalte im Netz zu. Kinder und Jugendliche sind mit dieser Problematik oft alleine gelassen.
Die Themenpalette reicht von Rassismus, Mobbing, Tierquälerei, Pornografie, Radikalisierung bis hin zu selbstschädigenden Bereichen wie Ritzen und Selbstmord. „Von der Polizei wissen wir, dass in letzter Zeit rechtsradikales Material wie Nazisticker wieder häufiger im Umlauf waren“, sagt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin der Initiative Saferinternet. Für Jugendliche sei es laut der Expertin schwierig, Inhalte wie Gewalt und Hass zu bewerten, die auf sie einströmen, ob über TikTok oder Instagram. Damit seien sie oft alleine gelassen.
Bucheggers Appell lautet: „Eltern, kümmert euch um eure Kinder, lasst euch zeigen, welche Plattformen sie im Netz besuchen, habt ein gutes Gesprächsklima, lasst die Kinder online nicht im Stich. Helft ihnen wenn es um die Beurteilung von Inhalten geht, indem ihr ihnen zeigt, wo sind vertrauenswürdige Seiten im Internet. Woher sollen sie denn wissen, wie man Quellen checkt und sich im Netz kundig macht, ohne Vorbildwirkung der Eltern und Lehrenden.“
MEDIENBILDUNG
In Österreich gibt es die digitale Grundbildung als verpflichtenden Unterrichtsgegenstand für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. In diesem Lehrplan sind neben den technischen Anwendungsprogrammen auch inhaltliche Medienbildungsthemen enthalten wie Informationsbewertung, Fake News erkennen, Auswirkungen, die problematische Inhalte im Netz auf Schüler:innen haben und die Reflexion der Nutzung der digitalen Geräte. Für Barbara Buchegger ist es wichtig, dass es medienpädagogische Angebote an allen Bildungseinrichtungen gibt, sowohl für Jung als auch für Alt, „damit wir alle lernen, besser mit den sozialen Medien umzugehen, sie für uns einschätzen zu können und uns selbst nicht in Gefahr zu bringen.“
Was die Regelungen in diesem Bereich betrifft, so trat ein neues EU-Gesetz gegen Hass im Netz (DSA, Digital Services Act) am 16. November 2022 in Kraft, das ab dem 17. Februar 2024 anzuwenden ist. Gemeinsam mit dem EU-Gesetz über digitale Märkte (DMA, Digital Markets Act) soll es klare und strenge Regeln für das Internet schaffen. Bereits 2020 wurde in Österreich das Kommunikationsplattformen-Gesetz gegen Hass im Netz von der Regierung verabschiedet. Es steht derzeit in der Kritik und soll laut EU rechtswidrig sein.
Infos und Hilfe unter: www.saferinternet.at
Telefonseelsorge Österreich: Notruf 142
Rat auf Draht Telefonberatung: 147, www.rataufdraht.at




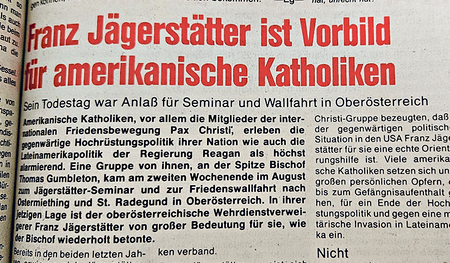



 Jetzt die
Jetzt die