
Inferno über Attnang-Puchheim

Der Bahnknotenpunkt mit Anschlussstellen zu den Rüstungsbetrieben in Ebensee und Redl-Zipf, die große Anzahl an Elektro- und Dampflokomotiven, ein eigener Vorbahnhof für zusätzliche Umladungen – all das vermittelte den Alliierten Streitkräften den Eindruck, dass der Bahnhof Attnang-Puchheim eine zentrale Schaltstelle im zusammenbrechenden Deutschen Reich wäre. Eine Einschätzung, die zu einer schrecklichen Katastrophe führte. Der Lokalhistoriker Direktor Helmut Böhm hat Anlass und Ablauf des Bombardements minutiös recherchiert und in mehreren Büchern beschrieben. Um 10.47 Uhr begann das Inferno. Dreihundert Bomber der 9. und 15. Amerikanischen Luftflotte haben ihre zerstörerische und todbringende Last über Attnang-Puchheim abgeworfen. Nach knapp drei Stunden drehten die letzten Flugzeuge auf ihre Basen in Italien, Frankreich und Belgien ab. Was zurückblieb, hat sich tief in das Bewusstsein der Bevölkerung eingeprägt. Das Gebiet um den Bahnhof war nicht wiederzuerkennen. Dafür hatten an die 2.300 Bomben gesorgt.
Großangriff
Der Angriff war überdimensional und zwei Wochen vor Kriegsende taktisch überflüssig, lautet das Urteil der Historiker. Eva Kurz, die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigt und für das 75-Jahr-Gedenken einen Film mit Zeitzeug/innen initiiert hat, hält nichts von Vergleichen mit anderen Gemeinden, um das Grauen zu beschreiben, macht aber doch auf ein Faktum aufmerksam: Im Verhältnis zu den rund 5.600 Bewohner/innen hatte Attnang-Puchheim die höchste Opferrate Österreichs.
Ohne Vorwarnung
Warum gerade an jenem 21. April kein Voralarm ausgelöst wurde, um auf die nahenden Bomber aufmerksam zu machen, konnte nie geklärt werden. So hat der Angriff die Menschen völlig überrascht, die Einheimischen ebenso wie die Flüchtlinge und Verletzten, die sich in Zügen befanden, die gerade zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof standen und nur auf die Weiterfahrt gewartet hätten. Tausende liefen um ihr Leben, als die ersten Bomben fielen. Mehr als 700 Menschen fanden den Tod: in einstürzenden Gebäuden, aus Jagdflugzeugen erschossen, von Bomben zerfetzt, von den Druckwellen erstickt. Nur 200 der Opfer konnten identifiziert werden, die große Mehrheit musste man als unbekannt begraben.
Neuanfang
Der Wiederaufbau war sehr, sehr mühsam, erklärt Eva Kurz. Strom, Wasser, Kanalisation – alles zerstört. Auch die Schule war getroffen, die ebenfalls nahe Kirche blieb so gut wie verschont. Nur die Fenster waren zerborsten. „Und ein Puffer eines Waggons landete am Dachboden“, weiß Johann Holzinger aus Erzählungen. Der Propst des Stiftes St. Florian stammt aus Attnang. Obwohl nicht getroffen, wurde die Kirche zu einem Symbol des Wiederaufbaus. Zu Kriegsbeginn standen nur die Apsis und das halbe Langhaus, dann stellte man die Arbeiten ein. 1951 konnte der Bau vollendet und eingeweiht werden. Auch die Erhebung zum Markt 1955 war eine Anerkennung des Einsatzes der Bevölkerung für den Wiederaufbau durch die öffentliche Hand.
Die Präsentation des Films und ein festlicher Gottesdienst zum 75-Jahr-Gedenken des Bombardements werden im Oktober 2020 nachgeholt.


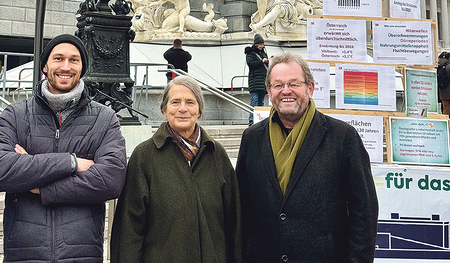




 Jetzt die
Jetzt die