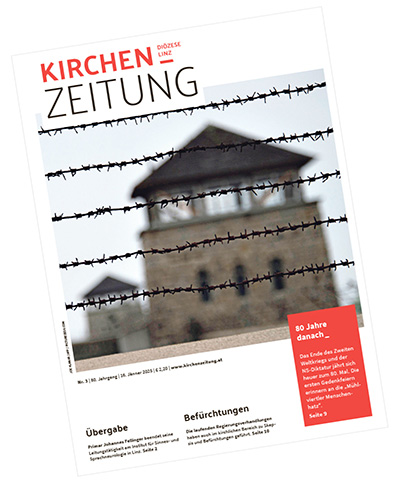
„Hildegard Burjan hat Frauen den Weg in die Politik bereitet“

Was war für Hildegard Burjan der Anlass, in die parlamentarische Parteipolitik zu gehen?
Schödl: Bald nachdem sie 1909 nach Wien gekommen war, begann sie sich mit der Elendslage der Heimarbeiterinnen auseinanderzusetzen. Sie erkannte rasch, dass Mildtätigkeit allein nicht ausreicht um deren Situation zu verändern, sondern dass vor allem die gesetzlichen Grundlagen geändert werden müssen. Burjan gründete 1912 den 1. christlichen Heimarbeiterinnen-Verband und setzte sich für deren Rechte öffentlich ein. Als 1918 das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt wurde, gerieten die Parteien unter Zugzwang, politisch interessierte und versierte Frauen zu finden. Auf Hildegard Burjan wurden die Christlichsozialen infolge ihres sozialen Engagements aufmerksam.
In der Konstituierenden Nationalversammlung saßen acht Frauen: Sieben Sozialdemokratinnen und mit Burjan nur eine Christlichsoziale. Warum?
Schödl: Hildegard Burjans Charisma entsprach sicher nicht dem Frauenbild der Zeit. Sie traute sich etwas zu, was vor allem Frauen der bürgerlichen Schicht noch scheuten. Als gläubiger Mensch sah sie es auch als ihre Pflicht an, sich in die Politik einzubringen. Ihr Grundsatz „Volles Interesse für die Politik gehört zum praktischen Christentum“ gilt auch für heute. Politik wird nur kritisch beurteilt, aber kaum jemand will sich selbst engagieren.
Wie waren Burjans Kontakte zu den sieben Sozialdemokratinnen?
Schödl: Generell war das politische Klima damals sehr aufgeheizt. Burjan begann aber bald den Kontakt über Parteigrenzen hinweg zu suchen. So brachte sie den Entwurf für das erste Heimarbeiterinnen-Gesetz gemeinsam mit der Sozialdemokratin Adelheid Popp ein. Stolz verwies sie darauf, dass dies der erste Gesetzesentwurf von Frauen für Frauen sei. Bezeichnend dafür ist auch, dass ihr Ausscheiden aus der aktiven Politik von der Sozialdemokratie sehr bedauert wurde.
Und wie erging es Burjan mit der eigenen, christlichsozialen Fraktion?
Schödl: Da hatte sie Schwierigkeiten. Zum Beispiel beim neuen Hausgehilfinnen-Gesetz. Für eine Berufsgruppe, in der es die höchste Selbstmordrate gab, sollten endlich gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Einige Parteikollegen sahen dies kritisch und meinten, Burjan mache die Dienstboten nur „närrisch“. Auch ihre jüdische Herkunft spielte sicher eine Rolle. So meinte der spätere Heeresminister Carl Vaugoin, als die nächste Kandidatur für den Nationalrat bevorstand, dass er sich kein weiteres Mal in seinem Wahlkreis von einer „Saujüdin“ vertreiben lasse.
Nimmt man die kurze Zeit im Wiener Gemeinderat dazu, dann war Burjan nur rund zwei Jahre politisch aktiv. Warum ist sie bei der Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung 1920 nicht mehr angetreten?
Schödl: Sie selbst nannte drei Gründe: erstens zu wenig Zeit für ihre Familie; zweitens ihre angeschlagene Gesundheit; und drittens der Klubzwang. Sie meinte, dass sie nicht alle Klubentscheidungen immer mit ihrem Gewissen vereinen könne. Auch der bestehende Antisemitismus spielte eine Rolle. Vor allem wollte sie sich, was sie als ihre Lebensaufgabe sah, widmen: dem Aufbau der von ihr gegründeten Schwesterngemeinschaft „Caritas Socialis“.
Welche Bedeutung haben die zwei Jahre im Parlament in ihrem Leben?
Schödl: Ich bin überzeugt, dass sie durch ihr Engagement beigetragen hat, für die Frauen den Weg in die Politik aufzubereiten. Auch in der Kirche, die lange vehement gegen ein politisches Engagement von Frauen war, hat sie dadurch etwas bewirkt.
Das Frauenwahlrecht 1918 bedeutete ja noch keine allgemeine Gleichberechtigung. Bis 1975 galt der Mann gesetzlich als Familienoberhaupt. Welches künftige Bild der Frau in der Gesellschaft hatte Burjan?
Schödl: Sie war da sicher ihrer Zeit weit voraus, wenn sie die Forderung aufstellte: „Frauenrecht ist alles, was die Frau zu ihrem Schutz und zur Erfüllung ihrer Menschheitsrolle von Staat und Gesellschaft fordern kann“. Sie sah auch, dass gesellschaftspolitische Maßnahmen fast immer auf den Rücken der Frauen stattfanden. So forderte sie nach dem Ende des Krieges, dass die Frauen, die während der Kriegszeit „ihren Mann“ stellen mussten, „nicht die ersten Opfer einer wieder männerorientierten Arbeitsmarktpolitik werden dürfen“. Etwas, was übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 auch aktuell war.
Hildegard Burjan wird manchmal mit zwei Politikern in Verbindung gebracht, den Bundeskanzlern Ignaz Seipel und Engelbert Dollfuß. Letzterer hat die Demokratie in Österreich zerstört. Welcher Art waren diese Kontakte?
Schödl: Hier muss man deutlich unterscheiden: Mit Seipel verband sie eine tiefe Freundschaft. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren, hat er ihre Ansichten zumindest in Betracht gezogen. Tagebucheinträge lassen darauf schließen, dass er oft bei den Burjans zu Gast war. Bei Dollfuß lässt sich keine engere Beziehung feststellen. Die Burjans führten ein offenes Haus, in dem Menschen aus Politik und Wirtschaft ein- und ausgingen, so auch die Familie Dollfuß. Als Dollfuß begann, seine politischen Pläne zu verwirklichen, war Burjan schon sterbenskrank. Sie starb am 11. Juni 1933. «
Hildegard Burjan
Die 1883 in Görlitz (Deutschland) geborene Tochter aus einer liberal-jüdischen Familie erwarb in Zürich ein Doktorat in Philosophie. Nach einer schweren Erkrankung und einer unerwarteten Heilung konvertierte sie 1909 zum Katholizismus und übersiedelte mit ihrem Mann Alexander Burjan nach Wien, wo sie 1912 den Verband der christlichen Heimarbeiterinnen, 1918 den Verein „Soziale Hilfe“ und 1919 die Schwesterngemeinschaft „Caritas Socialis“ gründete. Nachdem ihre Krankheit wieder ausgebrochen war, starb sie 1933. Sie wurde 2012 seliggesprochen.
Das Frauenwahlrecht
Hintergrund
Die Entwicklung des Frauenwahlrechts hing zwar an der Demokratisierungsbewegung insgesamt, hinkte in manchen Staaten aber stark hinterher.
Immerhin gilt die Regelung der britischen Pitcairn-Inseln von 1838 als erstes „nachhaltiges“ Frauenwahlrecht. 1869 führte der US-Bundesstaat Wyoming das Frauenwahlrecht ein.
In Österreich sah das Wahlrecht im Entwicklungsschritt von 1873 eine Beschränkung auf Männer mit mindestens 10 Gulden Steuerleistung vor, die in vier Wahlklassen unterteilt waren. In der Kurie des Großgrundbesitz wurden aber auch „Frauenspersonen, welche eigenberechtigt, 24 Jahre alt und vom Wahlrechte nicht ausgeschlossen sind, als wahlberechtigt behandelt“. Da aber nur rund sechs Prozent der männlichen Bevölkerung über 24 Jahren wahlberechtigt waren, kann man sich vorstellen, wie wenige Frauen abstimmen durften.
Schutz? Noch 1889 hatte man empfohlen, ehrbare Frauen zu ihrem eigenen Schutz vor dem „Beeinflussungsterrorismus“ von Wahllokalen fernzuhalten. Mit der Wahlrechtsreform 1907 wurde in der österreichischen Reichshälfte ein allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Männerwahlrecht eingeführt, aber die wenigen Frauen der obersten Wählerklasse verloren ihr Wahlrecht. Letzteres war schon in den 1880er Jahren in manchen Landtagswahlordnungen geschehen.
Im Zuge der Entstehung großer Massenparteien kam es dann zu einer breiten Diskussion über das Frauenwahlrecht. Aber erst am 18. Dezember 1918 beschloss die Provisorische Nationalversammlung der Republik Deutschösterreich ein Wahlrecht „ohne Unterschied des Geschlechts“ (Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919). Allerdings kursierten anfangs noch Ideen wie jene, Frauen mit andersfärbigen Stimmzetteln abstimmen zu lassen, um ihr Wahlverhalten sichtbar zu machen.
In der Schweiz wurde das Frauenwahlrecht auf Bundesebene erst 1971 eingeführt. Im konservativen Kleinstkanton Appenzell Innerrhoden haben die stimmberechtigten Männer den Frauen das Wahlrecht noch 1990 mehrheitlich verwehrt. Der Kanton musste vom Bundesgericht zur Einführung des Frauenwahlrechts gezwungen werden.










 Jetzt die
Jetzt die