
Grillhendl mit 6 Beinen

Der Eingang zur Ausstellung lädt eigentlich gleich zum Verweilen ein: Ein Festzelt mit Bierbänken und Schank sowie einer Grillhendlstation warten auf Gäste.
„Wir stellen uns die Frage, was im Bierzelt der Zukunft auf dem Teller liegen wird“, sagt Stephan Rosinger, Künstlerischer Leiter des Museums Arbeitswelt Steyr. „Wird es das gute alte Grillhendl sein, wie wir es kennen? Wird es ein Tofu-Huhn sein oder Fleisch, das im Labor gezüchtet wurde? Oder werden wir uns von Insekten ernähren?“
Das Huhn zieht sich als durchgängiges Motiv durch die Ausstellung, die aus vier Teilen besteht: Produktion, (globaler) Handel, Lebensmittelwahl im Supermarkt und Konsum.
INSEKTEN ESSEN?
Der Bereich Produktion spannt den Bogen von der Bodenbearbeitung im Zeitalter der Industrialisierung 1870 über die gegenwärtige Forschung bis hin zu möglichen Zukunftsentwürfen. „Heutige Trends wie der Selbstversorgergarten oder Konzepte für Vertical Gardening haben ihre Wurzeln in der Geschichte“, sagt Rosinger.
Beispielsweise stellte der viktorianische Gutsbesitzer Vincent M. Holt bereits 1885 in einem gleichnamigen Essay die Frage: „Warum nicht Insekten essen?“ Auf viel Zuspruch scheint er allerdings damals nicht gestoßen zu sein. „Die Idee lebte dennoch weiter“, sagt Rosinger und zeigt auf eine kleine Schachtel in der nächsten Vitrine.
„Zirp“ steht darauf; es handelt sich um ein Wiener Start-up, das Produkte aus Insekten zum Kochen und Backen herstellt. Bei der Eröffnung der Ausstellung am 16. Februar werden unter anderem Insektenburger verkostet, die auch aus der Hand von „Zirp“ stammen. „In vielen anderen Kulturkreisen ist der Verzehr von Insekten ganz normal“, erinnert Rosinger.

GLOBALER HANDEL, ABER FAIR
Anhand von Zucker, Soja, Kaffee und dem Hauptmotiv Huhn werden globale Zusammenhänge des Lebensmittelhandels dargestellt. Spannendes Faktum und vielleicht nicht allen bekannt: Österreich ist europäischer Spitzenreiter bei der Produktion und Verarbeitung von Lebensmittelsoja. Oberösterreich gehört gar zu den Bundesländern mit der höchsten Anzahl an Anbauflächen.
„Eine der wichtigsten Fragen, die wir stellen möchten, ist: Wie wird ein globaler Handel mit Nahrung möglich, der auf Nachhaltigkeit und Fairness für alle basiert?“, sagt Rosinger. „Oft blenden wir bei der Wahl von Lebensmitteln gewisse Aspekte aus. Wie etwa die Arbeitsbedingungen der Menschen bei Ernte oder Produktion sind, oder welche ökologischen Kosten es gibt.“
Auch der Einsatz von Lebensmitteln als Waffe (Beispiel Getreidelieferungen während des Ukrainekriegs) oder die soziale Dimension des Essens im Fall von politischen Krisen oder Umstürzen sowie die Betrachtung gewisser Ernährungstrends werden thematisch nicht ausgelassen.
SICH SELBST HINTERFRAGEN
Besonders die zweite Hälfte von „Future Food“ lädt die Besucher:innen ein, das eigene Kauf- und Ernährungsverhalten zu hinterfragen. An Umfragestationen kann angegeben werden, welche Kriterien einem bei der Wahl des Lebensmittels am wichtigsten sind: der Preis, der Geschmack, die Gesundheit oder die Nachhaltigkeit? Außerdem wird gefragt, wie oft Fleisch gegessen oder wie oft selbst gekocht wird.
Im letzten Ausstellungsraum wird schließlich auf die Auswirkungen des Konsums hingewiesen: „Es macht einen Unterschied, ob ich mit dem Auto zum Supermarkt fahre oder mit dem Fahrrad“, gibt Rosinger ein Beispiel.
Am Ende wieder zurück im Bierzelt, betrachtet man das Grillhendl auf dem Pappteller möglicherweise mit anderen Augen.
„Future Food – Essen für die Welt von morgen“, Museum Arbeitswelt Steyr, Eröffnung Do, 16. 2., 19 Uhr, Anmeldung: anmeldung@museumarbeitswelt.at



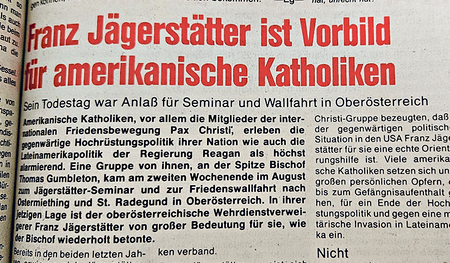



 Jetzt die
Jetzt die