Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Flammen schlagen aus den Fenstern der Synagoge in der Linzer Bethlehemstraße. In den Morgenstunden haben Angehörige der nationalsozialistischen Kampforganisationen SA und SS Feuer gelegt. Die Polizei hat alles penibel dokumentiert. Nur eingegriffen hat sie nicht. In der Früh des 10. November 1938 ist das 60 Jahre zuvor errichtete Gebetshaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mit der Synagoge wird auch die jüdische Gemeinde völlig vernichtet. Seit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 vergeht keine Woche, in der nicht Wohnungen und Geschäfte jüdischer Familien „arisiert“ – also enteignet oder zwangsweise verkauft – wurden und immer neue Schikanen das Leben der Gemeinde einschnüren. Linz ist das Zentrum jüdischen Lebens in Oberösterreich. Bei der Volkszählung 1934 haben sich 966 Personen zum jüdischen Glauben bekannt. Der Großteil von ihnen wohnt in Linz, wo es eine Synagoge, eine „Jüdische Bildungsstelle“ und jüdische Sport- und Jugendvereine gibt.
Neben Linz bestand auch in Steyr eine eigenständige jüdische Kultusgemeinde. Der Kultusverein hatte sich kurz vor der Jahrhundertwende von Linz losgelöst. Von den damals 200 Mitgliedern, den Geschäftsinhabern, Rechtsanwälten, Ärzten, Handwerkern und Arbeitern und ihren Familien waren im Jahr 1938 nur noch 62 zurückgeblieben. Viele Menschen, vor allem junge, waren nach Wien gezogen oder ausgewandert. Die Arbeitslosigkeit war in den 1930er-Jahren besonders in der „Eisenstadt“ sehr hoch. Der seit Langem schwelende Antisemitismus hatte massiv zugenommen, auch die Spannungen zwischen den politischen Gruppierungen. Die dramatischen Ereignisse des Jahres 1938 haben Karl Ramsmaier und das „Mauthausen Komitee Steyr“ zusammengetragen: Bereits im Juli 1938 wurden neun Juden von der Geheimen Staatspolizei verhaftet, darunter Steyrs letzter Rabbiner Chaim Nürnberger. Im November entgingen die Synagoge in der Bahnhofstraße, Geschäfte und Häuser nur deshalb der Zerstörungswut der Nationalsozialisten, weil sie kurz zuvor „arisiert“ worden waren. Am 8. und am 10. November wurden weitere jüdische Bürgerinnen und Bürger verhaftet (siehe auch Randspalte). Ein Gefängniswärter kümmerte sich um die Inhaftierten. Er sei sehr erregt gewesen, weil er alle gekannt habe und sogar Kinder ins Gefängnis gekommen seien, erinnert sich ein Zeitzeuge.
Auch in Gmunden gab es ein reges religiöses und gesellschaftliches jüdisches Leben. Heinrich Marchetti hat es für die Gmundner Chronik penibel erforscht. Mitte der 1930er-Jahre lebten 100 Juden in Gmunden, sie konnten einen Friedhof mit Aufbahrungshalle errichten und den Speiseraum der Villa Adler zu einem Betraum umgestalten. Für die Festtage und den Religionsunterricht reisten Rabbiner aus Linz an. Für die Gmunder Juden eine unbefriedigende Situation, sodass sie sich um die Gründung einer eigenen israelitischen Kultusgemeinde bemühten. Es wäre neben Steyr und Linz die dritte in Oberösterreich gewesen. Die Gmundner Gemeinde hätte auch die einzelnen jüdischen Familien in den Bezirken Vöcklabruck, Braunau und Ried betreut. Aber dazu kam es nicht mehr. Der Anschluss hatte die Lage völlig verändert.
Bereits am Sonntag, dem 13. März 1938, wurde mit den jüdischen Bürgern Gmundens ein widerliches Schauspiel veranstaltet. In einer Prozession trieb man sie durch die Straßen, am Stadtplatz mussten sie auf vorbereiten Sesseln Platz nehmen. Dort wurden sie stundenlang verhöhnt und beschimpft. Wer künftig in jüdischen Geschäften einkaufte, fand sich am „Judenpranger“ wieder. Dies war eine Spalte im „Salzkammergut Beobachter“, in der die Namen jener veröffentlicht wurden, die trotz Verbots in jüdische Geschäfte gingen.
Auch der jüdische Friedhof wurde geschändet. Man ließ Schweine auf dem Areal weiden. Schweine gelten in der jüdischen Religion als unreine Tiere. Zwar gab es Zeichen der Solidarität mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dies konnte aber nichts an der Vernichtung von deren wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Existenz ändern. Im Sommer 1938 verließ ein Großteil der jüdischen Familien Gmunden. Wie in der ganzen „Ostmark“ waren auch für die Gmunder Juden die Monate nach dem Anschluss eine einzige „Reichskristallnacht“, sodass für die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Gmunden keine Aktionen mehr bekannt sind.
Im benachbarten Bad Ischl war es ähnlich. Zwar gab es dort eine Reihe jüdischer Familien und man hatte auch einen Betsaal eingerichtet, aber für die „November-Pogromnacht“ sind keine Ausschreitungen bekannt. Der Grund dürfte in der nur mehr geringen Zahl der jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner liegen, die zu jener Zeit noch im Salzkammergut lebten, erklärt der Historiker Michael Kurz. Er hat die Parteichroniken und Lokalzeitungen ausgewertet und ist für November 1938 im gesamten Salzkammergut auf keine Aktionen gestoßen. Derselbe Befund zeigt sich auch für die anderen Bezirke Oberösterreichs – mit Ausnahme von Linz. Kurz weist aber auf Feiern in Erinnerung an den 9. November 1923 hin, die in der gesamten Region begangen wurden. Die Nationalsozialisten gedachten der ersten Toten ihrer „Bewegung“, die 1923 beim gescheiterten Putsch Hitlers in München ums Leben gekommen waren. Hunderte Menschen hätten sich am 9. November 1938 zu einer „Helden“-Feier im Kurhaus Bad Ischl versammelt, der Saal habe gar nicht alle Besucher fassen können, berichtet das „Salzkammergut Heimatblatt“. Ein bislang nicht beachteter Vorfall in Bad Ischl könnte aber doch mit der „Reichspogromnacht“ in Zusammenhang stehen: Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden hatte am 8. November den Gendarmerieposten Bad Ischl beauftragt, alle männlichen Juden festzunehmen. Der Posten meldete, dass am 10. November sechs Männer verhaftet wurden. Weder der Anlass für die Maßnahme ist bekannt, noch ist nachweisbar, was mit den Gefangenen in der Folge geschehen ist. Das Datum des Ereignisses lässt aber aufmerken.
Zwei weitere Zentren des Judentums waren Rosenberg und Krumau – im heutigen Tschechien. Seit das Sudetenland Anfang Oktober 1938 vom Deutschen Reich annektiert worden war, standen die an Oberösterreich angrenzenden Gebiete in enger Verbindung zum „Gau Oberdonau“, bis sie diesem schließlich 1939 auch rechtlich zugeschlagen wurden.
In Rosenberg an der Moldau befanden sich eine Synagoge und zwei jüdische Friedhöfe. Die Informationen über Vorkommnisse sind spärlich. Es kursiert die Erzählung, dass bereits im September 1938 SS-Einheiten aus Linz die Synagoge in Rosenberg in Brand gesteckt hätten. Das ist schwer nachvollziehbar, völlig unmöglich ist es aber nicht. Von Krumau, dessen renovierte Synagoge heute zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört, ist nur bekannt, dass die Synagoge verwüstet wurde. Ein sudetendeutscher Bewohner Krumaus kann sich erinnern – er war damals ein Volksschulkind – , dass in der Folge die Hitlerjugend die Synagoge nutzte und dort an einem Segelflugzeug bastelte. Von der Schändung des Krumauer Friedhofs gibt es keine Überlieferung. Vom Schicksal der mehr als einhundert jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Krumaus ist wenig bekannt.
„Am 10. November 1938, um fünf Uhr morgens, verhaftete man uns. Man nannte es ‚Schutzhaft‘.“ – Anni Berger, geborene Uprimny, war
18 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von den Nationalsozialisten in Steyr verhaftet wurde. „Während wir im Gefängnis saßen, verwüstete man unsere Wohnung und stellte die Fotos davon öffentlich zur Schau. Als meine Mutter wieder nach Hause kam und das Chaos sah, regte sie sich schrecklich auf. (...) Sie schimpfte über die Hausbewohner, die aber denunzierten sie, worauf sie gleich noch einmal verhaftet wurde. Sie war so verzweifelt, dass sie nicht mehr leben wollte.“ Anni Bergers Mutter, Margarethe Uprimny, wurde 1942 mit den beiden jüngsten Kindern Heinzi und Mirjam im Vernichtungslager Maly Trostinec in Weißrussland ermordet, der Vater Eduard Uprimny in Nisko in Polen. Anni Berger und ihre zwei älteren Brüder konnten nach Palästina flüchten. Jahrzehnte später hat sie ihr Schicksal für das Buch „Vergessene Spuren“ erzählt.
Gedenkveranstaltung in Steyr am 8. November 2018


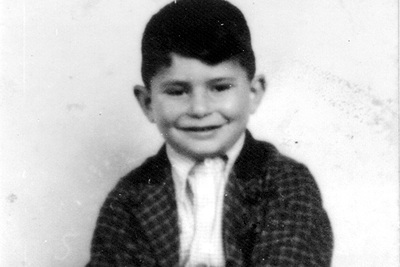

Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.
Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>
 Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>