
Betreuung von Kindern (nicht) leicht gemacht

In manchen Gemeinden gebe es eine gute Infrastruktur an Kinderbetreuungseinrichtungen, in anderen können Vater oder Mutter nicht einmal einer Vollzeitarbeit nachgehen: So lautet die Zusammenfassung des Kinderbetreuungsatlas 2025, den die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Empirische Sozialforschung (IFES) erstellt hat. 313 Gemeinden in Oberösterreich haben sich daran beteiligt, 125 Gemeinden (28,5 Prozent) übermittelten keine Daten.
Gemischtes Bild
Dennoch ergibt sich für die AK das Bild von Oberösterreich als eines der „Kinderland-Schlusslichter im Bundesländer-Vergleich“. Es fehle in vielen Gemeinden an vollzeittauglichen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen. Gerade einmal 6,7 Prozent der unter Dreijährigen und 38,9 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen seien in Oberösterreich derart betreut. Das fehlende Angebot stehe zudem in direktem Zusammenhang mit der hohen Teilzeitquote von Frauen im Bundesland, die fast 60 Prozent betrage. „Fest steht, dass das institutionelle Kinderbildungs- und -betreuungsangebot in vielen Gemeinden nicht zu den immer flexibler werdenden Arbeitszeiten der Eltern passt“, heißt es in einer Aussendung der AK OÖ.
Da der Kinderbetreuungsatlas der AK keine offizielle Erhebung des Landes OÖ sei, wolle man dessen Ergebnisse auch nicht kommentieren, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander. Stattdessen wird auf die offiziellen Erhebungen der Kindertagesheimstatistik verwiesen, die auch die Statistik Austria in ihrem jährlichen Bundes-Monitoring-Bericht verwende.
Gesetzlicher Rahmen
„Das Land OÖ hat den gesetzlichen Rahmen geschaffen, dass Kinder so lange betreut werden, wie es dem Bedarf der Eltern entspricht“, sagt Christine Haberlander. „Gesetzlich festgelegt ist dabei eine Mindestöffnungszeit von 47 Wochen sowie die Klarstellung, dass Einrichtungen, wenn drei Kinder am Nachmittag einen Bedarf haben, auch wirklich so lange offen haben müssen, wie der Bedarf ist.“ Die aktuellen Zahlen des Kinderland-Monitoring-Berichts hätten erneut gezeigt, dass das Angebot größer ist als die Inanspruchnahme: Fast 90 Prozent der Kindergartenkinder könnten bis 16 Uhr betreut werden, jedoch würden lediglich Eltern von 14 Prozent der Kinder dies tatsächlich nutzen. „Das deckt sich auch mit den Ergebnissen des Bundes-Monitoring-Berichts. Dieser zeigt klar, dass 85 Prozent der Mütter von unter Sechsjährigen in Teilzeit keinen Wunsch nach mehr Arbeitsstunden haben“, heißt es aus dem Büro Haberlander.
Verschiedene Gründe
Die Entscheidung von Eltern, ob, wann und wie oft sie ihr Kind in eine Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung geben möchten, hänge mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen, die sich je nach der individuellen Familiensituation auch rasch ändern könnten. „Aktuelle Studien dazu belegen, dass es größtenteils eine persönliche Entscheidung der Mutter oder auch des Vaters darstellt, ab wann und wie viel gearbeitet wird, wenn die Familie junge Kinder hat“, sagt Haberlander. Das tatsächliche Betreuungsangebot spiele laut der Studie der Uni Wien (2023) nur eine untergeordnete Rolle. Demnach gaben 67 Prozent der Mütter (deren jüngstes Kind zwei Jahre alt war) an, deshalb in Teilzeit zu arbeiten, weil sie „selbst betreuen möchten“. Für 14 Prozent war „kein passendes Betreuungsangebot vorhanden“, für 10 Prozent war es „zu teuer“.
Ausbau notwendig
Die AK OÖ weist unter anderem darauf hin, dass Oberösterreich von der Erfüllung der Barcelona-Ziele noch weit entfernt sei: Bereits 2002 hat sich der Europäische Rat darauf geeinigt, dass mindestens 33 Prozent der unter Dreijährigen und 90 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen einen Betreuungsplatz haben sollen. Im Rahmen der Europäischen Kinderbetreuungsstrategie von 2022 wurden die Zielwerte auf 45 Prozent und 96 Prozent angehoben. „Damit alle Familien eine echte Wahlfreiheit und gleiche Chancen haben, muss mehr in den Ausbau der Kinderbildung und -betreuung investiert werden. Um für ein flächendeckendes, vollzeittaugliches Angebot zu sorgen, muss das Land Oberösterreich mehr Geld für die Gemeinden zur Verfügung stellen. Zur Deckung des Fachkräftebedarfs braucht es auch eine Ausbildungsoffensive“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.
SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter, die sich ebenfalls auf die AK-Zahlen bezieht, kritisiert, dass das Land die Gemeinden im Stich lasse: „Unsere Gemeinden bemühen sich nach Kräften, gute Kinderbetreuung anzubieten. Viele haben in den letzten Jahren trotz knapper Kassen investiert und innovative Lösungen gefunden. Aber sie können den flächendeckenden Ausbau vollzeittauglicher Kinderbetreuung nicht so leisten, wie es sich die oberösterreichischen Familien verdient hätten.“
Hohe Quote
Oberösterreich liegt laut dem Bundes-Monitoring-Bericht bei den drei- bis fünfjährigen Kindern mit einer Betreuungsquote von 94,4 Prozent über dem Österreich-Durchschnitt, teilt man seitens der Landeshauptmannstellvertreterin mit. Mit 152 zusätzlichen Gruppen in den letzten beiden Jahren habe es bei den Krabbelstubengruppen so viel Zuwachs wie nie zuvor gegeben, zudem sei auch der Personalstand mit 13.023 Mitarbeiter:innen in der Kinderbetreuung so hoch wie nie (plus 1.715 in den letzten zwei Jahren). Diese fänden attraktive Rahmenbedingungen vor, sagt Haberlander: „Das Einstiegsgehalt für Pädagog:innen beträgt in Oberösterreich 3.300 Euro und der Urlaubsanspruch umfasst von Anfang an sieben Wochen.“ Nicht zuletzt habe Oberösterreich in absoluten Zahlen die zweitmeisten Krabbelstuben (nach Wien) und die zweitmeisten Kindergärten (nach Niederösterreich), was das „gute, flächendeckende Angebot unterstreicht“.


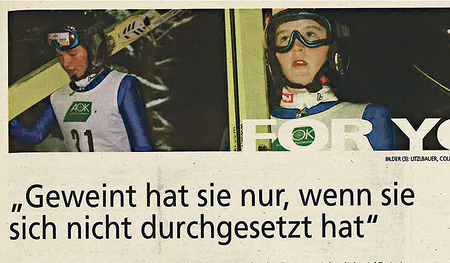



 Jetzt die
Jetzt die