Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.
Stimmen aus Österreich und der Welt zu Papst Franziskus

Sr. Katharina Ganz, OSF, Oberzeller Franziskanerinnen
Der Name Franziskus war Programm
Mit Franz von Assisi teilte der Papst den selbstgewählten Namen, die Liebe zur Schöpfung und zu Benachteiligten.
Franz von Assisi wollte evangeliumsgemäß leben, radikal arm und geschwisterlich. Glaubwürdig gelang dem gleichnamigen Papst die vorrangige Option für die Armen. Konsequent nahm er die Perspektive des globalen Südens ein und prangerte Ausbeutung und Gleichgültigkeit gegenüber Migrantinnen und Migranten an.
Augenhöhe, aber keine Demokratie
Leider dauerte es lange, bis er zur selben Parteinahme für Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kirche gelangte und systemische Ursachen anerkannte. Ein wichtiger Schritt für die Ökumene war, dass sich Papst Franziskus Bischof von Rom und Patriarch des Westens nannte. Doch innerkirchlich blieb er absolutistischer Monarch einer pyramidal verfassten Hierarchie. Gleichzeitig stieß er den weltweiten synodalen Prozess an. Dabei wirkten auch Männer und Frauen ohne Weihe mit am ordentlichen Lehramt des Papstes. Von demokratischer Mitbestimmung, wie sie in der franziskanischen Familie konstitutiv ist, blieb das Pontifikat aber weit entfernt.
Parallelen und Unterschiede
Die Lehrschreiben „Laudato siʼ“ und „Fratelli tutti“ mit der Sorge für die Schöpfung als gemeinsames Haus und die Vision einer globalen Geschwisterlichkeit atmen den Geist Franzʼ von Assisis, der sich an alle Gläubigen und Menschen guten Willens wandte, den Lenkern der Völker ins Gewissen redete und den Dialog mit Muslimen pflegte.
Menschenbild und Kirchenbild des Papstes blieben gefangen in veralteten Geschlechterstereotypen („marianisch“ und „petrinisch“), während sein Namensgeber Geschlechtergrenzen überwand.

Michael Max, Santa Maria dell'Anima Rom
Franziskus, der Bischof von Rom
Jeder Papst ist auch Diözesanbischof von Rom. Nicht jeder seiner Vorgänger hat diese Aufgabe aber so ernst genommen wie Franziskus.
Vom Anfang seines Pontifikates an hat sich Papst Franziskus als Bischof von Rom gesehen. Dass das für ihn kein leerer Titel war, wurde bald klar, als er begann, für Veränderungen in seiner Diözese zu sorgen. So wurde der Lateranpalast, der antike Sitz der Päpste neben ihrer Bischofskirche San Giovanni in Laterano, für Besucher geöffnet. Und Franziskus begann, seine Dokumente mit „gegeben im Lateran“ zu unterzeichnen, obwohl er die gesamte Amtszeit weiter im Vatikan wohnen blieb und auch seine Amtsgeschäfte von dort aus
führte.
Ein herausforderndes Vorhaben
Dass die personelle und inhaltliche Neuaufstellung seiner Diözese Rom selbst für einen Papst durchaus dicke Bretter zu bohren sind, wurde allerdings auch schnell deutlich. Zwei Kardinalvikare ernannte er im Laufe der Zeit, zahlreiche Weihbischöfe kamen dazu, die früher oder später in andere italienische Diözesen weiterzogen. Im Jänner 2023 erließ er die Apostolische Konstitution „In ecclesiarum Communione“ (In der Gemeinschaft der Kirchen), mit der er seine Rolle als Bischof strukturell stark machte und den Betrieb an seinen zentralen Anliegen – Synodalität und Evangelisierung – ausrichtete.
Baustelle offen
In der Ökumene, wo die Ausübung des Petrusdienstes stets ein wichtiges Thema ist, wurde das als wichtiger Schritt positiv zur Kenntnis genommen. Doch irgendwie blieb das Gefühl, dass der Papst hier eine pastorale Baustelle geöffnet hat, die, ähnlich wie manche Baustelle während des Heiligen Jahres, sein Pontifikat überdauern wird.
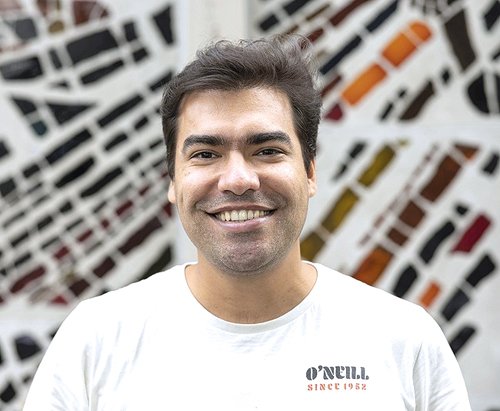
P. Delfor Nerenberg SVD, Dornbirn
Der Mann aus Argentinien
Franziskusʼ argentinische Wurzeln zeigten sich besonders in seinem Führungsstil, in der Spiritualität und pastoralen Vision.
Schon als Kardinal in Buenos Aires verzichtete Jorge Mario Bergoglio auf Privilegien und nutzte z. B. den öffentlichen Nahverkehr. Diese Haltung prägte sein Pontifikat und zeigte sich in der „Theologie des Volkes“, einer argentinischen Strömung, die die Weisheit der einfachen Menschen als Schlüssel zu einer gerechteren Gesellschaft betrachtet.
Franziskus bewahrte seine argentinische Identität auch in Gesten und Symbolen. Oft teilte er mit Pilgern oder Pilgerinnen einen Mate-Tee – ein starkes Zeichen von Gemeinschaft. Ebenso war seine marianische Frömmigkeit tief geprägt von seinem Heimatland, besonders die Verehrung der Schutzpatronin Nuestra Señora de Luján.
Lebt nicht „vom Balkon aus“!
Seine Sprache war sehr direkt und voller argentinischer Ausdrücke. Jugendliche forderte er auf, „Hagan Lio“ – macht ein Durcheinander –, um sich aktiv einzubringen. Ebenso ermutigte er, „das Leben nicht vom Balkon aus zu betrachten“, sondern aktiv teilzunehmen. Als Fußballfan nutzte Franziskus den Sport als Metapher für das Leben. Junge Menschen rief er auf, „Meister des Lebens“ zu werden. Diese Bilder machten seine Predigten alltagsnah.
Bescheidener Lebensstil
Papst Franziskus setzte sich Zeit seines Lebens für soziale Gerechtigkeit ein. Bereits in Argentinien begleitete er die Armen und kämpfte gegen Korruption. Als Papst förderte er eine arme Kirche für die Armen. Sein bescheidener Lebensstil unterstrich diese Botschaft.
Papst Franziskus blieb seiner argentinischen Identität treu. Mit Schlichtheit und Mitgefühl führte er die Kirche als einen Ort der Barmherzigkeit und Hoffnung.

Ernst Fürlinger, Religionswissenschaft Donau-Uni Krems
Andere Religionen schätzte er hoch
Angesichts einer von Krisen, Kriegen, Konflikten und geopolitischen Verwerfungen erschütterten Gegenwart ist es kein geringes Verdienst von Papst Franziskus, dass er die dialogische Haltung gegenüber den anderen Religionen seit dem Zweiten Vatikanum nicht nur fortsetzte, sondern stärkte – sowohl durch Dokumente als auch durch interreligiöse Initiativen.
Er setzte dabei wichtige neue Akzente: mit der Betonung persönlicher interreligiöser Freundschaft sowie der praktischen Zusammenarbeit der Religionen für die Lösung der globalen Herausforderungen. Mit seinem entschlossenen Engagement für den interreligiösen Dialog stärkte er insgesamt ein Verständnis von zeitgenössischem Christentum, das sich nicht fundamentalistisch von der religiös und weltanschaulich pluralen Gesellschaft zurückzieht.
Abu Dhabi und der Großimam
Globale politische Bedeutung hatte seine Politik der Vertrauensbildung gegenüber den muslimischen Institutionen, die er mit Beginn seines Pontifikats startete. Wichtigste Frucht davon ist das „Dokument über die Geschwisterlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt“, das Papst Franziskus und Großimam Ahmad Mohammad Al-Tayyeb von Kairo 2019 in Abu Dhabi unterzeichneten.
Kultur der Begegnung
Offen blieb: die Theologie des religiösen Pluralismus, die in seinen Texten und Handlungen enthalten ist und die einen christlichen Absolutheitsanspruch aufgibt, in ein lehramtliches Dokument zu fassen.
Alle, die in der Praxis einer interreligiösen „Kultur der Begegnung“ engagiert sind, blicken mit großer Dankbarkeit auf diese Dimension seines Wirkens zurück.

Johann Pock, Pastoraltheologie Uni Wien
Europäische Kirche wurde Weltkirche
Dass Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien kam, prägte seine kirchenpolitische und inhaltliche Schwerpunktsetzung.
Papst Franziskus war der erste Papst aus Lateinamerika. Mit der Amazonien-Synode setzte er 2019 ein zentrales Zeichen: „Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“ – damit setzte er nicht nur im Blick auf die Klima- und Ökologiefragen, sondern auch hinsichtlich des Umgangs mit Minderheiten und mit indigenen Bevölkerungen neue Maßstäbe.
Die Ränder: Geografisch und sozial
Franziskus veränderte die Kirche nicht zuletzt dadurch, dass er bis zuletzt vornehmlich Kardinäle aus der Peripherie auswählte. Bleiben wird sein Ansatz, dass die Kirche „an die Ränder gehen muss“ – und er meinte dies sowohl geografisch wie auch im Blick auf die Menschen, die gesellschaftlich an den Rändern sind. Dies zeigte sich nicht zuletzt in seinem Engagement für Migrant:innen.
Entschuldigung für Kolonialisierung
Mit seinen Reisen erreichte Papst Franziskus ebenfalls die Ränder der Welt: Sri Lanka und Philippinen (2015), Thailand und Japan (2019), Mosambik, Madagaskar und Mauritius (2019), Mongolei (2023), Kongo und Südsudan (2023), Indonesien, Singapur, Papua-Neuguinea und Osttimor (2024).
In einer Botschaft im April 2023 bat er für den Beitrag von Christen zur Kolonialisierung in Amerika und Afrika um Vergebung und sprach sein Bedauern aus, dass Christen zum Prozess der sowohl politischen wie auch territorialen Beherrschung von Völkern beigetragen hatten.
Trotz seines Engagements gerade für Länder des Südens wurden manche seiner Botschaften, wie jene zur positiven Sicht auf die Homosexualität, speziell in Afrika stark kritisiert.

Magdalena Weigl, Regenbogenpastoral, Katholische Jugend
Und die gleichgeschlechtliche Liebe
Als Seelsorger, der „alle, alle, alle“ Menschen willkommen hieß, vertrat Papst Franziskus scheinbar andere Standpunkte als in seiner Rolle als Hüter der Lehre.
Papst Franziskus bewies immer wieder, dass er ein fähiger Seelsorger war. Er nahm die Menschen und ihre Anliegen ernst, hörte ihnen zu und sprach Gutes zu. Er erfüllte, was viele sich von der Kirche erhoffen. Er teilte seine Überzeugung von Gottes Liebe, die in der Liebe zwischen den Menschen sichtbar wird. Seine Worte stärkten, machten Mut und gaben Hoffnung. Er sprach von Dingen, die die Menschen betreffen, und zeichnete so ein zukunftsweisendes Bild unserer Kirche.
Zwischendurch gab es auch andere Momente: Situationen, in denen die Vielfalt der Lebensrealitäten zugunsten der kirchlichen Lehrmeinung in den Hintergrund gedrängt wurde. Vorschläge boten dann doch weniger Platz für individuelle Lebensentwürfe, und kirchliche Dokumente klangen dann doch menschenfern.
Mit Liebe zur Wirklichkeit
Zum Glück passierte Ersteres wesentlich öfter als Letzteres. Je nach Situation gab es eine Vielfalt an Möglichkeiten, die gelebte Praxis war lebendig und menschennahe. Rom und seine Dokumente lagen nicht immer nah, die Weltkirche und ihre Herausforderungen manchmal doch weit weg.
Menschen fühlten sich willkommen
Ich bin dankbar, dass Papst Franziskus großteils mutig blieb, dass er die Strukturen und Traditionen der Kirche auf ihre Gegenwartstauglichkeit überprüfte, sich selbst und die ganze Kirche herausforderte und so Räume schuf. Räume, in denen sich viele unterschiedliche Menschen willkommen und wohlfühlen konnten und können, weil sie, so wie sie sind, gewollt sind – nicht nur von Gott, auch von der Kirche.

Myriam Wijens, Kirchenrecht Universität Erfurt
Kirchenrecht: vom Lehren zum Hören
Der Papst ist oberster Gesetzgeber der Kirche. Durch Änderungen im Kirchenrecht hat Franziskus Spuren hinterlassen.
Das Vermächtnis von Papst Franziskus ist, dass die Kirche durch Solidarität und Nähe zu den Menschen die Barmherzigkeit Gottes verkündet. Auf dem Gebiet des Kirchenrechts zeigt sich das, indem Franziskus für wiederverheiratete Geschiedene Wege zur umfassenden Beteiligung am Leben der Kirche eröffnete und u. a. das Eheprozessverfahren vereinfacht und verkürzt hat.
Missbrauch verletzt Menschen
Der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen wurde nicht länger als Vergehen von Klerikern gegen ihre Verpflichtungen, sondern als Verletzung der Würde des Menschen eingestuft. Papst Franziskus hat Normen, mittels derer Leitungspersonal bei inadäquatem Reagieren auf Vorwürfe des Missbrauchs entlassen werden kann, erlassen und hat Bischöfe und Kardinäle zur Rechenschaft gezogen, indem sie sogar aus dem Klerikerstand entlassen wurden.
Gleiche würde auf Grund der Taufe
Dass Frauen als Richterinnen eingesetzt werden, wurde erweitert und verstärkt. Mit der Neuordnung der Römischen Kurie können auch Frauen Dikasterien leiten, zwei wurden von ihm ernannt. Damit hat Franziskus den Weg geebnet, dass dies auch auf Bistumsebene geschehen kann. Mittels der Synode über Synodalität, in der sich erstmals alle Gläubigen beteiligen konnten, hat er die Kirche von einer lehrenden in eine hörende Kirche transformiert, die die Gleichheit in Würde auf Grund der Taufe unterstreicht. Auch männliche Laien und Frauen erhielten ein Stimmrecht. Das betont eine Mitverantwortung aller für die Sendung der Kirche. Insgesamt hat Franziskus durch zahlreiche Gesetzesänderungen die Rechte der Gläubigen gefördert.

Thomas Roithner, Friedensforschung Universität Wien
Seine Stimme für den Frieden fehlt
Franziskusʼ unermüdliche Botschaften für Frieden und gegen Krieg wurden von verschiedenen Seiten missverstanden. Dennoch waren sie nicht umsonst.
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Papst Franziskus hat Wesentliches geleistet, dieses „mehr“ verständlich zu machen. Keinen Zweifel ließ Franziskus daran, dass die dringlichen Probleme miteinander verbunden sind: Bewahrung der Schöpfung und Frieden. Sein Verdienst: nicht nur die Oberfläche der Gewalt erkennen, sondern auch dahinterliegende Strukturen von Ungerechtigkeit und Armut benennen. Ja, manchen war es zu deutlich und manchen zu pauschal, wenn er ausführte: „Rüstung und Klimakrise führen zu Krieg“.
Jeder Krieg ist eine Niederlage
Die DNA von Franziskus zeichnete sich dadurch aus, dass Betroffene und Opfer in ihrer ganzen Würde immer im Mittelpunkt standen. Dazu gehörte auch, nicht nur die öffentlich unübersehbare Gewalt zu thematisieren, sondern gegen vergessene Kriege gewaltfrei anzukämpfen: Sudan, Myanmar, Kongo, Kolumbien und viele weitere Gewaltkonflikte. „Der Krieg“, so Franziskus, „ist eine Niederlage!“
Viele Menschen leiden unter Hunger und Katastrophen, während „weiterhin Waffen gebaut und verkauft und Ressourcen verbrannt“ werden, wie Papst Franziskus im Sommer 2024 anprangerte.
Aufgeheizte Debatten um Krieg und Frieden brachten aber auch Franziskus unter Kritik. Sein Aufruf zum „Mut der weißen Fahne“ wurde als Plädoyer für Unterwerfung gedeutet, während er über Verhandlungen sprach. „Frieden schafft man nicht mit Waffen, sondern durch geduldiges Zuhören, Dialog und Zusammenarbeit“, so Papst Franziskus. Eine Stimme, die sehr fehlt.

Kardinal Christoph Schönborn
Unveräußerliche Würde
Mit den drei spanischen Worten „todos, todos, todos“ („alle, alle, alle“) hat der am Ostermontag verstorbene Papst Franziskus stets deutlich gemacht, dass niemand ausgeschlossen werden darf – unabhängig von Herkunft, Glauben, sozialem Status oder sexueller Orientierung: Mit diesen Worten hat Kardinal Christoph Schönborn in der ORF-Sendung „ZIB Spezial“ die „tiefe Überzeugung“ von Franziskus zusammengefasst, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde habe. Die Kernfrage des Papstes sei dabei gewesen: „Bist du bereit, auch wenn er dein Feind ist, den anderen zu respektieren?“. Konkret habe sich das etwa in seinem Engagement für Geflüchtete, für interreligiösen Dialog und für eine Kultur des Friedens gezeigt. Selbst am Tag vor seinem Tod habe er in der Osterbotschaft für Frieden und Abrüstung plädiert, sagte Schönborn. Der Tod des Papstes an einem Ostermontag nannte der Kardinal „bewegend“ und erinnere an den Tod von Johannes Paul II., der „am Ende der Osterwoche“ 2005 verstorben war. Es zeige auch die Grundbotschaft des Christentums: „Der Tod hat nicht das letzte Wort.“

Erzbischof Franz Lackner
Stimme für den Frieden
Tief betroffen vom Tod des Papstes hat der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, die vielfältigen Verdienste von Papst Franziskus gewürdigt: „Er zeigte uns die Kirche, die sich den Armen zuwendet, den Benachteiligten, den Unterdrückten; die all jenen nachgeht, die ihr fern sind. Er war eine Stimme für den Frieden in einer Welt des Krieges, er weinte öffentlich um das Leid der Unschuldigen.“ Franziskus habe überrascht mit seinem Auftreten bei seiner Wahl, „er überraschte uns mit seinen Impulsen, mit der Synodalität, die wir als sein Vermächtnis weiter leben wollen“.

Ahmad al-Tayyeb, Großimam der Kairoer Azhar-Universität
Franziskus – Symbol der Humanität
Der Großimam der Kairoer Azhar-Universität, Ahmad al-Tayyeb, hat den verstorbenen Papst als engen Freund der Muslime gewürdigt. „Heute hat die Welt ein Symbol der Humanität verloren“, schrieb al-Tayyeb, einer der angesehensten islamischen Gelehrten, aktuell auf X.
Auch in Österreich bekundete die Islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ ihre Trauer zum Tod von Franziskus. Er sei ein „unermüdlichen Förderer des interreligiösen Dialogs“ gewesen, der sich stets für die Verständigung zwischen Christentum und Islam eingesetzt habe. „Seine Botschaft von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden ist ein bleibendes Vermächtnis“, so die IGGÖ.

Nora Tödtling-Musenbichler, Caritas Präsidentin
Ein echter Caritas-Papst
Mit Papst Franziskus „verliert die Welt eine unermüdliche Stimme für soziale Gerechtigkeit, für die Armen und Ausgegrenzten, für Geflüchtete und für den Schutz unserer Schöpfung“, erklärte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress. Sein Engagement sei „nie bloße Theorie – sondern gelebte Nächstenliebe“ gewesen, betonte sie. „In vielerlei Hinsicht war er ein echter Caritas-Papst.“ Während seines zwölfjährigen Pontifikats habe Franziskus die Kirche „aufgerüttelt“ und daran erinnert, „dass der Platz der Kirche an der Seite der Schwächsten sein muss“. Besonders hob Tödtling-Musenbichler den einfachen Lebensstil und die klaren Worte des Papstes hervor, mit denen er „nicht nur die Gläubigen bewegt, sondern weit über die Kirche hinaus Hoffnung geschenkt“ habe.
Impressionen aus dem Leben des verstorbenen Papstes















 Jetzt die
Jetzt die