Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.
Freude am Blühen anderer - Bischof Manfred Scheuer wird 70

Inwiefern hat Ihre Kindheit in Haibach ob der Donau Sie geprägt?
Bischof Manfred Scheuer: Ich bin in einer Bäckerfamilie großgeworden, wir hatten auch eine kleine Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen und Hühnern. Das Mithelfen bei der Getreide-, Heu- und Kartoffelernte gehört zu meinen frühen Kindheitserinnerungen. In der Bäckerei hatte ich ebenfalls eine Aufgabe: Ich habe schon mit dreieinhalb, vier Jahren Semmeln und Brot zugestellt. Dadurch, dass wir ins Gei gefahren sind, habe ich von klein auf praktisch alle Haushalte der Gemeinde kennengelernt. Und ich habe früh Kopfrechnen gelernt. Eine Semmel kostete damals 55 Groschen. Das alles war schon prägend für mich. Ich bin dankbar dafür, dass ich als Kind das Leben, die Lebensmittel in Form von Brot und landwirtschaftlichen Produkten als etwas ganz Kostbares schätzen gelernt habe. Auch in den Rhythmus des Jahreskreises bin ich hineingewachsen. Auf das Feiern der Feste haben wir uns wirklich gefreut. Geprägt haben mich auch meine Großeltern, besonders ein Großvater, der 1890 geboren war und der uns viel aus seinem Leben erzählt hat. Zum Beispiel, wie er als kleines Kind zum Requiem für Kaiserin Sissi gehen musste.
Gab es Lieblingsbücher, die Ihre Kindheit und Jugend begleitet haben?
Bischof Manfred Scheuer: Zunächst einmal habe ich religiöse Zeitschriften wie „Der Pfeil“ gelesen. Die Erlebnisberichte und die Erschließungen der Liturgie des Kirchenjahres habe ich noch in Erinnerung. In der Volksschulzeit habe ich, glaube ich, auch einmal „Das Licht der Berge“ von Franz Weiser gelesen, das hat mich fasziniert. Karl May haben wir auch gelesen: Old Shatterhand, Old Shurehand, Das Land der Skipetaren … Aber diese Bücher haben mich nicht ein Leben lang begleitet. „Das Licht der Berge“ und die Serles, die darin vorkommt, die haben mich dann in Innsbruck wieder eingeholt. Auf die Serles bin ich zu jedem runden Geburtstag gegangen. Ich habe dort auch das Gipfelkreuz gesegnet. Dieser Berg gehört bis heute jedes Jahr zwei-, dreimal zu meinem alpinistischen Programm.
Können Sie sich noch erinnern, wann Ihre Berufung gereift ist?
Bischof Manfred Scheuer: Angeblich habe ich schon in der zweiten Klasse den Wunsch geäußert, dass ich Pfarrer werde, wie man damals gesagt hat. Auch meiner Erinnerung nach habe ich diesen Wunsch sehr früh gehabt. Das hat dazu geführt, dass ich gleich am Tag meiner Erstkommunion, am Nachmittag des Christi-Himmelfahrts-Tages, das erste Mal bei einer Andacht ministriert habe. Ich bin dann auch relativ bald Wochentags-Mesner geworden, schon in der vierten Klasse Volksschule. Meinen Heimatpfarrer, der historisch gebildet war und in Kirchengeschichte promoviert hat, habe ich wegen seiner Klugheit bewundert. Im Petrinum habe ich vielfältige Erfahrungen von Gemeinschaft gemacht. In Verbindung mit Grenzerfahrungen durch den Tod von Freunden hat das in mir den Wunsch wachsen lassen, Theologie zu studieren beziehungsweise Priester zu werden. Reif ist aber eine andere Sache – reif sind die wenigsten, die siebzig sind. (Schmunzelt)
Gab es auch andere Berufswünsche?
Bischof Manfred Scheuer: In der Volksschule habe ich mich sehr für Heimatkunde interessiert, später dann für Geografie, für Österreich, Europa und die Welt. Schwerpunktthema bei der Matura war Lateinamerika – und Tirol. Warum ich Tirol gewählt habe? Das habe ich erst später als Hinweis gesehen. Ich glaube, dass Berufung immer auch etwas mit früher Kindheit zu tun hat und auch mit jugendlichen Interessen. Das kann ich nicht einfach hinter mir abschneiden, auch wenn das noch nicht ganz erwachsen oder ausgereift ist. Insofern glaube ich, dass jede Lebensphase oder auch jede Altersstufe ihre je eigene Berufung hat. Und auch, dass ich in jeder Lebensphase Jesus begegnen kann – und das verwirklichen kann und soll, was mir gegeben oder auch aufgegeben ist.
Sie sprechen oft von „generativen Menschen“ – Menschen, die Freude am Blühen anderer haben. Gab es auf Ihrem Lebensweg solche Menschen, die Ihre Entfaltung gefördert haben?
Bischof Manfred Scheuer: Ich sehe den Begriff des generativen Menschen in einem Gegenüber zur reinen Autonomie oder zur reinen Selbstbestimmung. Ich lebe, glaube ich, schon so, dass ich mich verdanke. Das, was ich bin, was ich reden kann, was ich arbeiten kann, das verdanke ich auch anderen. Natürlich auch der eigenen Anstrengung und der eigenen Arbeit. Aber dass ich die Sprache habe und erlernt habe, verdanke ich denen, die mich angesprochen haben. Dass ich das Leben als schön empfinden kann, verdanke ich denen, die mich angelächelt, umarmt und geliebt haben. Und dass ich auch etwas tun kann oder lernen kann, dass ich wachsen kann, verdanke ich denen, die mir etwas zugetraut und mir eine Aufgabe gegeben haben. Ein Kind, das nicht gelobt wird, hat vielleicht manches Interesse, aber es weiß nicht, wofür das gut ist, es erfährt keine Resonanz. Resonanz hat etwas damit zu tun, dass andere sich freuen, wenn es mir gut geht, wenn etwas gelingt. In meinem Leben war das ganz stark mein Großvater, dann auch Lehrer und geistliche Begleiter in Linz im Petrinum oder auch im Priesterseminar und später, in der Gregoriana und im Germanicum in Rom, zwei Jesuiten.
Sie haben schon an unterschiedlichen Orten in Österreich und Deutschland gelebt und sind auch als Bischof viel unterwegs. In welchen Situationen erleben Sie Beheimatung?
Bischof Manfred Scheuer: Ich bin insgesamt sicher fünfzehn, sechzehn Mal übersiedelt. Früher hat man gesagt: Zweimal übersiedeln ist einmal abbrennen. Die Frage ist immer: Was nehme ich mit, was muss ich zurücklassen? Das bedeutet ja letztlich auch, dass ich Heimat nicht mitnehmen kann. Ich war und bin eine Mischung aus Wanderer, Vagabund und Pilger. Sehr dankbar bin ich dafür, dass ich an ganz unterschiedlichen Orten die Gastfreundschaft von Menschen erfahren durfte und auch die Beziehungskultur je neu aufgebaut habe. Es ist fast nicht möglich, dass man von frühen Orten sehr viel mitnimmt, auch nicht an Beziehungen. Es macht einen Unterschied, ob ich einmal, zweimal im Jahr Freunde an früheren Orten besuche oder ob man doch ab und zu spontan gemeinsam etwas trinken gehen kann. Insofern ist der Begriff Heimat für mich sehr fragil. Ich würde auch nicht sagen, dass wir in diesem Leben ganz daheim sind.

Unterwegs in der Natur und mit den Menschen (Visitation in Steyr).
Sie sind leidenschaftlicher Bergsteiger. Was waren bzw. sind für Sie besondere Gipfelerlebnisse – auch im übertragenen Sinn?
Bischof Manfred Scheuer: Es gibt die sogenannten Grenzerfahrungen, auch in der humanistischen Psychologie oder auch bei Karl Jaspers. Da erfahre ich das Ureigene des eigenen Lebens, mit seinen Möglichkeiten und auch mit seinen Grenzen. Manchmal wachsen mir Kräfte zu, die ich bis jetzt in mir nicht erahnt habe. Das kann bei Erfahrungen der Musik oder der Kunst der Fall sein, bei spirituellen oder existentiellen Erfahrungen, in Beziehungen. Momente der intensiven Freude, auch der abgründigen Trauer. In diesem Sinn war für mich der Tod eines Freundes beim Bergsteigen ein Gipfelerlebnis, das zugleich ein Abgrund war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Gipfelerlebnisse erst durch die Treue im Alltag zu solchen werden. Dass ich zum Beispiel etwas als schön erfahre, braucht durchaus ja auch die Einübung. Dass ich spirituelle Erfahrungen mache, braucht auch die alltägliche Übung des Gebetes. Dass ich intensive Freundschaft erfahre, braucht auch die alltägliche Treue und die Wertschätzung.
Was waren oder sind die größten Herausforderungen in Ihrem Leben?
Bischof Manfred Scheuer: Manchmal sind kleine Dinge große Herausforderungen. Ich habe es beispielsweise als große Herausforderung gesehen, Menschen im Alten- und Pflegeheim zu besuchen, von denen ich wusste, dass sie die Kirche ablehnen. Manchmal ist eine Begegnung gelungen, manchmal bin ich wirklich abgeblitzt. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um damit umzugehen. Auch der Religionsunterricht war für mich durchaus eine Erfahrung, in der ich an Grenzen gekommen bin. Da weiterzugehen, nicht aufzugeben, das war eine Herausforderung. Insgesamt versuche ich, dass ich nicht auf die Größe der Herausforderung schaue, sondern Schritt für Schritt das mache, was jetzt möglich ist. Die Frage ist ja, wie gehe ich an Dinge, Aufgaben oder auch an Menschen heran? Sehe ich zuerst die Möglichkeit, die Chance oder zuerst die Schwierigkeiten und Hindernisse? Herausfordernd ist für mich gegenwärtig die Begleitung von Menschen in der Phase des Alters, der Demenz oder des Sterbens, wie ich sie zunehmend in meinem Bekanntenkreis und im beruflichen Umfeld erlebe. Im theologischen Bereich bleibt jede Predigt eine gewisse Herausforderung, ein Vortrag sowieso. In der gegenwärtigen Situation der Kirche ist es eine Herausforderung, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Zugängen umzugehen, Brücken zu bauen, weiterzugehen. Natürlich, ich kann nächste kleine Schritte tun, aber die große Lösung habe ich nicht.
Ihr bischöflicher Wahlspruch ist dem Johannesevangelium entnommen: „Der Geist macht lebendig“. Warum ist Ihnen dieses Wort wichtig, was verbinden Sie damit?
Bischof Manfred Scheuer: Ich glaube, dass der Heilige Geist für etliche Menschen eine Dimension Gottes erschließt, die ihnen der Vater oder der Sohn nicht eröffnen. Wichtig ist für mich die Unterscheidung der Geister. Nicht der Geist, der Weltgeist oder der Geist im Sinne Hegels ist schon der Heilige Geist, sondern es geht um eine liebende, lebendige Beziehung. Es gibt die Formulierung: Der Heilige Geist ist der Kuss zwischen Vater und Sohn. Das beinhaltet also durchaus die Dimension der Zärtlichkeit, der Intimität und Nähe. Der Heilige Geist ist Gemeinschaft. Und das gehört nach Augustinus zur Substanz und nicht zu den Nebensächlichkeiten der Dreifaltigkeitslehre. Für mich ist der Heilige Geist der Lebensspender, der Atem, der Trost oder auch der Lebendigmacher, der Beziehungsstifter, der Vollender. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern und Symbolen, die mit dem Heiligen Geist verbunden werden: der Wind, auch die Kraft, die Energie. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott nicht zu eindeutig definieren. Diese Bilder erschließen etwas von der Wirklichkeit Gottes, was dem Wort allein nicht möglich ist. Der Geist ist jedenfalls an Jesus gebunden. Und er ist dazu da, dass wir anderen nützen oder dass wir andere aufbauen. Er ist nie egoistisch, die Beziehung zu Jesus und die Beziehung zur Gemeinschaft ist das Entscheidende.

Bei der Weihe von Diakonen – eine bischöfliche Aufgabe.
Wenn Sie heute auf die Welt schauen: Welche Entwicklungen – positiv oder negativ – hätten Sie nicht für möglich gehalten?
Bischof Manfred Scheuer: Ich bin 1955 in die Zeit des Staatsvertrags hineingeboren worden. Zehn Jahre später habe ich die Übertragung des Festaktes im Belvedere bei unserem Nachbarn im Fernsehen gesehen. In dieser Zeit wurde das österreichische Bewusstsein erst wieder neu aufgebaut. Insgesamt war diese Zeit der 1960er und 1970er Jahre auch – und das habe ich erst im Nachhinein so gesehen – eine massive Transformation von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft. Innerhalb weniger Jahre hat sich zum Beispiel mein Heimatort, der zu siebzig oder achtzig Prozent von der Landwirtschaft geprägt war, zu einer Gemeinde gewandelt, in der nur noch drei, vier Bauern im Vollerwerb sind. Und diese Transformation wiederholt sich jetzt mit der Digitalisierung und der Globalisierung. Ich glaube, an der Digitalisierung kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist, wie wir sie zähmen beziehungsweise humanisieren, wie wir sie verantwortungsvoll gestalten. – Ich habe mich als Schüler schon sehr für Politik interessiert. Auch damals gab es schon Kriegszeiten, etwa den Vietnamkrieg, und die Demonstrationen dagegen. Insofern hat mich die politische Entwicklung der letzten Jahre nicht ganz so überrascht, weil Ansätze schon damals vorhanden waren. Ich kann mich auch an die ersten Anzeichen des Klimawandels erinnern, an den Club of Rome Anfang der 1970er Jahre und die Einführung der Energieferien.
Was macht Ihnen derzeit Sorgen, was Hoffnung?
Bischof Manfred Scheuer: Es macht mir Sorgen, dass die Fähigkeit zum Kompromiss und die Ausrichtung auf das Gemeinwohl in der Politik in den Hintergrund geraten sind. Es ist eine Errungenschaft der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man das Miteinander gesucht und gefunden hat – etwa in der Sozialpartnerschaft. Das Gemeinwohl gründet auf Haltungen: Wertschätzung, Bereitschaft zur Fürsorge und zum Verzeihen. Auch die Demokratie ist kein Selbstläufer. Trotz all der Kriege, die ich schon seit fast sechzig Jahren weltpolitisch wahrnehme, setze ich auf die Kräfte, die den Frieden wollen. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat gemeint, die Welt sei gespalten, weil sich die Prinzipien der Französischen Revolution auseinanderentwickelt haben. Die einen setzen auf die Freiheit, die anderen auf Gleichheit, aber es fehlt die Geschwisterlichkeit, die beides zusammenhält: die Wertschätzung, Anerkennung, Sympathie und Solidarität. Manches gelingt nicht auf rein rechtlicher Basis. Im Sinne der Gleichheit kann ich jedem ein Recht auf Pflege zusprechen. Aber was ist, wenn diesen Dienst niemand liebevoll und kompetent übernimmt? Der Philosoph Ivan Illich hat zudem auf die Bedeutung der Freundschaft hingewiesen, die man nicht nur unter seinesgleichen haben soll: Wichtig ist die Fähigkeit zu Beziehungen mit Andersdenkenden.
Bedeutet das, dass man Dialog um jeden Preis führen soll?
Bischof Manfred Scheuer: Ich halte es für richtig, das Gespräch nicht abreißen zu lassen. Wobei zu bedenken ist, dass natürlich nicht alle Dialogpartner gleich sprach- und konfliktfähig oder gutwillig sind. Dialog setzt ein gewisses Wohlwollen voraus. Bei Thomas von Aquin heißt es, dass ich in der Lage sein muss, die Position meines Gegners erstens zu benennen und zweitens die darin enthaltenen Vorzüge zu würdigen. So ringen wir gemeinsam um Lösungsansätze. Natürlich bleibt das oft im Vorläufigen. Aber das ist besser als gewalttätige Lösungen.

Ökumene-Bischof Scheuer auf der Befreiungsfeier in Mauthausen 2025, gemeinsam mit Michael Chalupka (li.) und Ioannis Nikolitsis (re.).
Papst Franziskus hat gemeint, wir sollen uns auch dann freuen, wenn beim Versuch, anderen die Liebe Christi zu vermitteln, kein erfolgreiches Ergebnis sichtbar ist. Was nährt bei Ihnen diese Freude?
Bischof Manfred Scheuer: Bei Hegel habe ich gelesen, dass ein Ergebnis so etwas wie ein Leichnam ist: Das ist abgeschlossen und vergangen, nichts Lebendiges, da tut sich nichts mehr. Wenn ich das Ergebnis eines Fußballspiels kenne, wird nicht mehr gespielt. Nicht nur das Ziel ist wichtig, sondern auch der Weg dorthin. Natürlich freue ich mich über ein Gipfelerlebnis, aber es macht einen Unterschied, ob ich mit der Seilbahn hinauffahre oder ob ich den Gipfel zu Fuß und nach einer guten Anstrengung erreiche. Es gibt so etwas wie die Mystik des Augenblicks – auch bei der Feier der Liturgie: Ein Tag, den ich mit einer Eucharistiefeier beginne, hat von vornherein eine andere Gestalt. Auch Erfahrungen der Freundschaft der Schönheit sind unverzweckt und nährend. Ich halte es für wichtig, dass wir den Sinn des eigenen Lebens, auch der eigenen Berufung, nicht am Erfolg messen, sondern an der Stimmigkeit.
Der Zukunftsweg der Diözese Linz heißt „Kirche weit denken“. Wo sollten wir weiter oder auch tiefer denken?
Bischof Manfred Scheuer: Fangen wir nicht mit dem an, was uns fehlt, sondern mit dem, was wir haben: Ich glaube, in unserem Land gibt es zum Beispiel viel Solidarität, hierzulande oder in der Entwicklungszusammenarbeit. Und es gibt gar nicht so wenige lebendige Pfarrgemeinden. In der Weite wachsen können wir zum Beispiel im Umgang mit fremdsprachigen katholischen Gemeinden. Wie können wir einander begleiten, befruchten, herausfordern, ergänzen oder korrigieren? Wenn es um die Vertiefung geht, sollten wir nicht bei den Strukturen und Machtfragen steckenbleiben. Entscheidender ist die Frage: Wie können wir Gott lieben? Wie kommt mehr Liebe und Freude in die Welt?
Sie leiten die Diözese Linz seit fast zehn Jahren. Was ist Ihnen in ihrem Hirtenamt wichtig?
Bischof Manfred Scheuer: Das ist schon allein deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil „leiten“ für manche ein Reizwort ist. Zudem stellt sich die Frage, ob Leitung dasselbe ist wie das Hirtenamt. Entscheidend ist nicht eine Funktion, sondern die Frage: Womit leite ich? Ganz wichtig ist mir die Verkündigung, weil die Kirche durch das Wort Gottes aufgebaut wird. Biblisch betrachtet bedeutet leiten, Gemeinden zu gründen, aufzubauen, zu fördern und wachsen zu lassen. Leiten heißt auch, entscheiden zu müssen. Das fällt mir durchaus manchmal schwer. Leiten heißt aber auch erschließen: durch Liturgie und Sakramente. Natürlich erwarten sich manche da und dort ein Machtwort von mir und manches müssen wir entscheiden – aber ich mache das nicht im Alleingang. Doch vergessen wir dabei nicht: Strukturen erschaffen nicht das Leben, gefragt sind vielmehr schöpferische Menschen, die Gemeinschaften aufbauen.
Aus Ihrer Erfahrung gesprochen: Was ist ein erfülltes Leben? Was wünschen Sie Kindern und jungen Menschen für ihren Weg?
Bischof Manfred Scheuer: Ich habe in den letzten Jahren mehrmals Menschen besucht und begleitet, die dann nach einem langen, erfüllten Leben verstorben sind. Blickt man auf ihr Leben, so war es ein Auf und Ab, etwas Fragiles, Verletzliches. Die Fülle besteht nicht nur aus der glücklichen Dimension, aus den Gipfelerlebnissen und Sternstunden, sondern auch aus dem Fragment, dem Darniederliegenden. Die Frage ist: Wie gehen wir mit den Höhen und Tiefen, den Erfolgen und Niederlagen um? Jesus hat gesagt, er sei gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Aber das ist beispielsweise auch ein Leben in Armut. Volles Leben meint, das Leben in allen Dimensionen auszuloten, auszukosten und trotz allem in der Hoffnung zu leben – verbunden mit der Bitte, ein liebender Mensch zu bleiben oder wieder zu werden. Kindern und jungen Leuten von heute wünsche ich ein gutes Fundament, einen Platz zum Leben und die Zusage: Ja, du kannst etwas, wir brauchen dich, du gehörst dazu. Und ich wünsche ihnen, dass sie das Geheimnis Gottes erahnen und spüren.
Runde Geburtstage tun manchmal ein bisschen weh, weil sie ans Älterwerden erinnern. Wie geht es Ihnen damit?
Bischof Manfred Scheuer: ‚Wehgetan‘ hat mir der Vierziger, da bin ich erstmals an meine körperlichen Grenzen gestoßen, etwa beim Bergsteigen. Damals hat sich auch meine ‚Beziehungswelt‘ geändert. Der Fünfziger hat weniger wehgetan. Als ich sechzig war, stand die Veränderung an, als Bischof von Innsbruck nach Linz zu wechseln. Also ein Neubeginn in einem Alter, in dem andere an die Pension denken. Heute merke ich, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt, bei der Arbeit und beim Bergsteigen. Und mir fällt auf, dass die Jungen öfter in anderen Welten leben, die mir nicht mehr so vertraut sind. Natürlich bekomme ich das eine oder andere mit und versuche es zu verstehen. Aber es ist nicht meine Welt. In meiner Innsbrucker Zeit hat mir ein alter Priester die Fragen mitgegeben: Was kann ich nicht mehr? Was kann ich noch? Was kann ich erst jetzt? Eine Bekannte hat mir gesagt: Alt werden ist nichts für Feiglinge. Es bringt die Erfahrung mit sich, dass manches Tragende wegbricht. Weggefährten sterben, das Berufsleben endet und hinterlässt vielleicht eine Leere. Altwerden ist auch eine Herausforderung für den Glauben. Ich bin allen dankbar, die sich mit Hingabe um ältere Personen kümmern.
Auch mit siebzig hat man noch Träume. Wovon träumen Sie?
Bischof Manfred Scheuer: Ich möchte lieber über zwei Visionen sprechen. Die erste geht auf Nikolaus Cusanus zurück. Er wird von Jesus angeschaut und sagt: Weil du mich anschaust und liebst, deshalb bin ich. Dein Sehen ist Lebendigmachen. Diese Erfahrung des liebenden Blickes wünsche ich älteren Menschen und auch mir. Die zweite Vision gründet auf Gedanken von Walter Benjamin zu dem Bild „Der Engel der Geschichte“ von Paul Klee. Hinter dem Engel sind die Trümmer der Vergangenheit aufgetürmt, teilweise auch die Leichen des Krieges. Und der Engel der Geschichte schaut mit Entsetzen auf dieses Bild und möchte diese Vergangenheit in eine erlöste Zukunft wenden. Das ist eine Vision von Auferstehung. Das ist neues, erfülltes Leben.
Der neue Papst Leo XIV. ist fast genauso alt wie Sie. Was wünschen Sie ihm? Was erbitten Sie von Gott für Ihren weiteren Lebensweg?
Bischof Manfred Scheuer: Ich glaube, für den Papst und die Bischöfe ist entscheidend, dass sie Zeugen der Auferstehung und der Hoffnung sind. Das erste Wort von Papst Leo XIV. nach seiner Wahl an die Öffentlichkeit war der Ostergruß des Auferstandenen an seine Jünger: Der Friede sei mit euch. Bei der Namenswahl haben viele an Leo XIII. gedacht, aber mir ist auch Leo I. ins Gedächtnis gekommen: Er und der heilige Augustinus waren Gestalter in einer Welt des Umbruchs und haben Verantwortung übernommen. Leo I. hat auch von der Würde des Menschen gesprochen. Ich denke, das bewegt auch den neuen Papst. Er ist Augustiner und war Kirchenrechtler. Er wird vermutlich das Verhältnis von Recht und Ethik etwas anders ausloten als Papst Franziskus. Aber vielleicht braucht es das jetzt wieder mehr. Was ich für Papst Leo XIV. und auch für mich erbitte? Den Segen Gottes.

Bischof Manfred Scheuer wurde am 10. August 1955 in Haibach ob der Donau geboren, seine Eltern führten eine Bäckerei. 1980 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Nach Tätigkeiten in der Seelsorge und als Universitätsprofessor wurde Manfred Scheuer 2003 zum Bischof der Diözese Innsbruck ernannt. 2016 wechselte er in die Diözese Linz. Scheuer ist stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz und österreichweit zuständig für Ökumene und Kontakte zum Judentum.














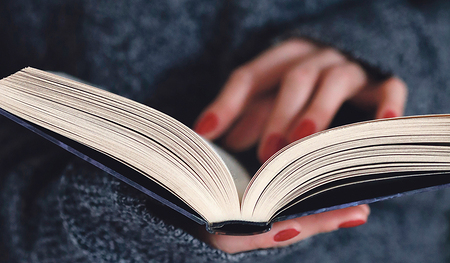

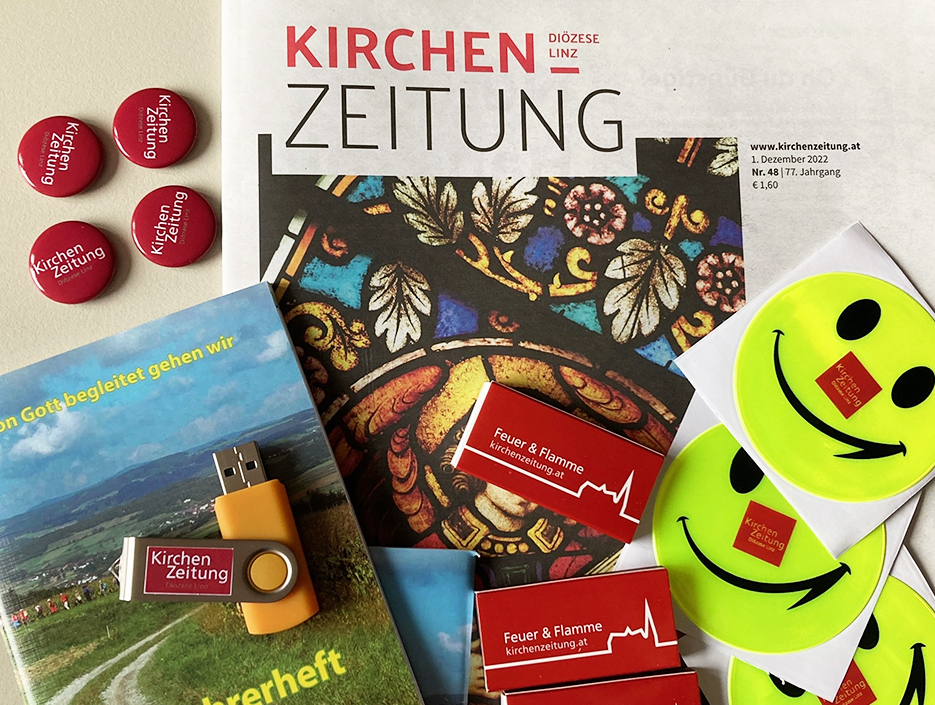
 Jetzt die
Jetzt die