BRIEF_KASTEN
„Kritische Wissenschafter haben da keinen Platz“
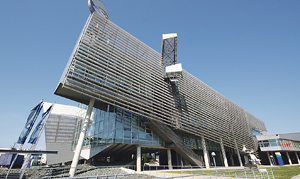
„Geld und Ethik“ – Finanzmärkte. Unter diesem Titel findet am 7. April in Wien ein eigener Lesekreis zum Sozialwort statt. Sie werden als Experte dabeisein. Worum geht es da?
Gabriel: Als das ökumenische Sozialwort erarbeitet und veröffentlicht wurde (2003), war eine derart dramatische Finanz- und Wirtschaftskrise, wie wir sie dann ab 2007/2008 erlebt haben, nicht absehbar. Es gab zwar ab der Mitte der 2000er Jahre warnende Stimmen, aber kaum jemand hörte auf sie, weil die Märkte boomten. Was waren die Ursachen, die zu den bis heute anhaltenden Erschütterungen führten?
Gabriel: Da hat es auf allen drei Ebenen des Wirtschaftens – auf der Makroebene der Finanzstrukturen, auf der mittleren Ebene der Unternehmen und auf der persönlichen Handlungsebene – äußerst problematische Entwicklungen gegeben. Da wurden zunächst unter dem Einfluss der neoliberalen Wirtschaftstheorie ab den 1980er Jahren viele Regulierungen im Bereich der Finanzmärkte abgebaut – nach dem Motto, dass der Markt selbst, wenn man ihn nur möglichst frei agieren lässt, am besten für Wachstum und Wohlstand sorgt. In der Folge kam es zu Kreditpraktiken und Finanzprodukten, die sich von der realen Wirtschaft immer mehr abkoppelten – etwa von der sinkenden Zahlungsfähigkeit des finanziell absinkenden US-amerikanischen Mittelstandes (siehe Hauskredite). In der Folge haben auch viele Unternehmen ihre Erträge nicht mehr in die eigene Produktion und die eigenen Arbeitsplätze investiert, weil man auf den Finanzmärkten mehr verdienen konnte. Und schließlich gab es unter den „Bankern“ und Investoren, auch unter dem Einfluss eines völlig überdrehten Boni-Systems, eine Art Goldgräberstimmung. Die Märkte wurden zu einem sich immer schneller drehenden Casino – bis dann die Blase mit dem Bankrott der Investmentbank Lehman Brothers dramatisch platzte. Mit welchen Auswirkungen?
Gabriel: Mit verheerenden Auswirkungen, weil ja nicht nur Reiche viel Geld verloren haben, sondern auch einfache Leute, die sich für undurchsichtige Finanzprodukte verschuldet hatten oder ihre private Altersvorsorge ver-
loren. Und weil es dann politisch nicht gelungen ist, dass die Finanzwirtschaft für die angerichteten Schäden selbst aufkommt, kam es zu einem Dominoeffekt nach unten. Statt der versprochenen Wohlstandsvermehrung kam es zu einer Wohlstandsverminderung, zum Teil sogar zu einer Vernichtung von Existenzen. Die heute nicht unumstrittenen Bankenrettungen, für die allein in EU-Europa unvorstellbare 1600 Milliarden Euro aufgewandt wurden, stürzten Länder, die schon vorher über ihre Verhältnisse gelebt hatten, in eine tiefe Krise (Griechenland u. a.) mit dramatischen Verarmungsfolgen für breite Bevölkerungskreise. Aber auch für relativ gut situierte Länder wie Österreich bedeutet ein Milliardengrab, wie es die Hypo-Alpe-Adria aufreißt, dass viele notwendige Investitionen in Bildung, Pflege oder Forschung momentan nicht gemacht werden können, ebenso wie die längst fällige Entlastung der Arbeitseinkommen. Außerdem löste die Krise in der Realwirtschaft einen Absatz-, Kredit- und Investitionsstau aus, der zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen führte. Was ist aus den „heiligen Schwüren“ der „großen Politik“ (G8-Gipfel in England etc.) geworden, dass man es nun besser machen wolle?
Gabriel: Von den angekündigten „großen Würfen“ und dem „internationalen Schulterschluss“ ist wenig übrig geblieben. Eine wirkliche Reform der internationalen Finanzmärkte ist nicht absehbar und der Spekulationsboom hat bereits wieder volle Fahrt aufgenommen. Zum Teil fehlt die Einsicht bei den Politikern, von denen ja immer noch welche so tun, als wäre die Finanzkrise wie ein Naturereignis vom Himmel gefallen, man redet ja auch von einem „Finanztsunami“. Zum anderen liegt das auch an der engen Verflechtung der herrschenden Bank- und Finanzlobby mit der Politik. Das sieht man ja auch im kleinen Österreich: Da wechseln die engsten Politikberater vom Bankensektor in das Kabinett der Minister und wieder zurück. Kritische Wirtschaftswissenschafter haben da keinen Platz. Das Schlamassel um die Hypo-Alpe-Adria ist auch unter diesem Aspekt zu sehen. Auch in der Europäischen Zentralbank kommen die Spitzen aus dem Bankenbereich (Goldman Sachs etc.). Vermutlich braucht man diese Leute auch, aber nicht nur! Einstein sagte einmal: Man kann Probleme nicht mit der Denke lösen, die die Probleme verursacht hat. Sie sehen also kein Licht am Horizont?
Gabriel: Es gibt, zumindest was ich in Europa sehe, durchaus einige Ansätze, die Sinn machen. Ein Beispiel wäre die gemeinsame Bankenaufsicht, die nationale Rücksichtnahmen und Verbandelungen durchbrechen könnte. Nur beobachte ich da, dass man die wichtigen Schritte bei den großen Instituten, etwa die Trennung von Bank- und Spekulationsgeschäften, bisher nicht gemacht hat, dafür aber die kleinen Sparkassen mit einem Wust an bürokratischen Pflichten überrollt; oder auch das Vorgehen der Finanzmarktaufsicht gegen innovative Finanzierungskonzepte, wie sie die Waldviertler Schuhwerkstatt (Heini Staudinger) oder Jugend Eine Welt versuchen. Mir kommt das vor wie bei einem Hausbau, wo man jede Schraube zählt, aber nicht darauf schaut, ob das Haus auch statisch in Ordnung ist. Ein Versuch, die Finanzinstitute stärker in die Pflicht zu nehmen, ist auch die Europäische Bankenunion, wo in einen Haftungsfonds eingezahlt wird – aber auch da scheinen nationale Egoismen schon wieder Löcher zu schlagen. Ein Fortschritt ist auch, dass zumindest elf EU-Länder bereit sind, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, um dadurch nicht nur einen Beitrag der Finanzmärkte zum Gemeinwohl zu lukrieren, sondern auch Zockerpraktiken auf den Finanzmärkten einzudämmen. Sie sprachen von einer notwendigen „NeuDenke“. Wo soll da, auch aus Sicht der Katholischen Soziallehre, angesetzt werden?
Gabriel: Die Soziallehre hat keine Rezepte, aber sie stellt von ihren Grundsätzen her entscheidende Fragen, die Papst Franziskus noch einmal zuspitzt – auch was das Gesamtkonzept der Wirtschaft angeht. Da stellt sich etwa die Frage, wie muss unsere Wirtschaft aufgestellt sein, damit Arbeit, Einkommen und Ressourcen so verteilt werden, dass sie möglichst allen ein „gutes Leben“ ermöglicht? Wie können wir Steuern so steuern, dass sie zu einem – auch demokratiepolitisch wichtigen – gerechten Ausgleich und zur Sicherstellung einer menschenwürdigen Grundversorgung beitragen? Wie können wir unser Sozialsystem sichern, das auf eine durchgängige Voll-erwerbsarbeit setzt, die es immer seltener gibt? Was bedeutet es, wenn die Entwicklung eines Landes nur am Bruttonationalprodukt
gemessen wird und dabei viele Leistungen wie familiäre Kinderbetreuung und Pflege oder Freiwilligen-Arbeit nicht eingerechnet werden? Wo brauchen wir eine innovative und auch risikobereite Finanzwirtschaft und ab wann schadet sie? Die große Herausforderung für die Kirchen sehe ich darin, dass wir uns nicht nur auf der individuellen Ebene für ein gutes Verhalten – etwa die ethische Geldanlage – einsetzen. Wir müssen auch auf der Ebene der Unternehmen für ein neues Geschäftsmodell eintreten und Hilfestellungen geben, damit z. B. ethische Geldveranlagung überhaupt sinnvoll ist. Und wir müssen uns auf der Makroebene, wo es um die Finanz- und Wirtschaftsarchitektur geht, offensiver einmischen und dazu auch Allianzen suchen. http://sozialwortzehnplus.org/
Als das Sozialwort der christlichen Kirchen Österreichs 2003 veröffentlicht wurde, war von der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise und den dramatischen Folgen noch keine Rede. Dennoch finden sich im Text Passagen, die im Kontext dieser Krise bedeutsam sind – auch wenn es nun einer „Nachschärfung“ bedarf. „Wo der Markt sich selbst überlassen bleibt, entsteht Ungleichverteilung von Einkommen, Vermögen und Beteiligungschancen. Aufgabe der Politik ist es, durch Bereitstellung einer allen zugänglichen Infrastruktur, durch eine ausgleichende Steuerund Sozialpolitik, durch rechtliche Regelung von Arbeit und Wirtschaft dafür zu sorgen, dass alle Menschen einen gerechten Anteil an den gemeinsam erwirtschafteten Gütern und Leistungen erhalten und menschenwürdig leben können.“ (Nr. 191) „Der Staat ist kein Unternehmen, das allein nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln kann. Politik muss auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Tatsächlich werden politische Entscheidungen allein nach wirtschaftlichen Effizienzkriterien getroffen.“ (Nr. 192) „Die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Österreich prüfen die Möglichkeit, ihr Vermögen vorwiegend in solchen Fonds anzulegen, die in Unternehmen investieren, die ihre Tätigkeit in überprüfbarer Weise nach Umwelt-, Sozialund Menschenrechtskriterien ausrichten.“ (Nr. 201) „Auch Christen und Christinnen sind aufgerufen … in ihren Geld- und Vermögensanlagen auf ethisches
Investment zu achten.“ (Nr. 202) „Die Kirchen treten für ein gerechtes Steuersystem ein, das die Belastung der Erwerbsarbeit verringert, dafür andere Faktoren stärker belastet.“ (Nr. 206)
Gabriel: Als das ökumenische Sozialwort erarbeitet und veröffentlicht wurde (2003), war eine derart dramatische Finanz- und Wirtschaftskrise, wie wir sie dann ab 2007/2008 erlebt haben, nicht absehbar. Es gab zwar ab der Mitte der 2000er Jahre warnende Stimmen, aber kaum jemand hörte auf sie, weil die Märkte boomten. Was waren die Ursachen, die zu den bis heute anhaltenden Erschütterungen führten?
Gabriel: Da hat es auf allen drei Ebenen des Wirtschaftens – auf der Makroebene der Finanzstrukturen, auf der mittleren Ebene der Unternehmen und auf der persönlichen Handlungsebene – äußerst problematische Entwicklungen gegeben. Da wurden zunächst unter dem Einfluss der neoliberalen Wirtschaftstheorie ab den 1980er Jahren viele Regulierungen im Bereich der Finanzmärkte abgebaut – nach dem Motto, dass der Markt selbst, wenn man ihn nur möglichst frei agieren lässt, am besten für Wachstum und Wohlstand sorgt. In der Folge kam es zu Kreditpraktiken und Finanzprodukten, die sich von der realen Wirtschaft immer mehr abkoppelten – etwa von der sinkenden Zahlungsfähigkeit des finanziell absinkenden US-amerikanischen Mittelstandes (siehe Hauskredite). In der Folge haben auch viele Unternehmen ihre Erträge nicht mehr in die eigene Produktion und die eigenen Arbeitsplätze investiert, weil man auf den Finanzmärkten mehr verdienen konnte. Und schließlich gab es unter den „Bankern“ und Investoren, auch unter dem Einfluss eines völlig überdrehten Boni-Systems, eine Art Goldgräberstimmung. Die Märkte wurden zu einem sich immer schneller drehenden Casino – bis dann die Blase mit dem Bankrott der Investmentbank Lehman Brothers dramatisch platzte. Mit welchen Auswirkungen?
Gabriel: Mit verheerenden Auswirkungen, weil ja nicht nur Reiche viel Geld verloren haben, sondern auch einfache Leute, die sich für undurchsichtige Finanzprodukte verschuldet hatten oder ihre private Altersvorsorge ver-
loren. Und weil es dann politisch nicht gelungen ist, dass die Finanzwirtschaft für die angerichteten Schäden selbst aufkommt, kam es zu einem Dominoeffekt nach unten. Statt der versprochenen Wohlstandsvermehrung kam es zu einer Wohlstandsverminderung, zum Teil sogar zu einer Vernichtung von Existenzen. Die heute nicht unumstrittenen Bankenrettungen, für die allein in EU-Europa unvorstellbare 1600 Milliarden Euro aufgewandt wurden, stürzten Länder, die schon vorher über ihre Verhältnisse gelebt hatten, in eine tiefe Krise (Griechenland u. a.) mit dramatischen Verarmungsfolgen für breite Bevölkerungskreise. Aber auch für relativ gut situierte Länder wie Österreich bedeutet ein Milliardengrab, wie es die Hypo-Alpe-Adria aufreißt, dass viele notwendige Investitionen in Bildung, Pflege oder Forschung momentan nicht gemacht werden können, ebenso wie die längst fällige Entlastung der Arbeitseinkommen. Außerdem löste die Krise in der Realwirtschaft einen Absatz-, Kredit- und Investitionsstau aus, der zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen führte. Was ist aus den „heiligen Schwüren“ der „großen Politik“ (G8-Gipfel in England etc.) geworden, dass man es nun besser machen wolle?
Gabriel: Von den angekündigten „großen Würfen“ und dem „internationalen Schulterschluss“ ist wenig übrig geblieben. Eine wirkliche Reform der internationalen Finanzmärkte ist nicht absehbar und der Spekulationsboom hat bereits wieder volle Fahrt aufgenommen. Zum Teil fehlt die Einsicht bei den Politikern, von denen ja immer noch welche so tun, als wäre die Finanzkrise wie ein Naturereignis vom Himmel gefallen, man redet ja auch von einem „Finanztsunami“. Zum anderen liegt das auch an der engen Verflechtung der herrschenden Bank- und Finanzlobby mit der Politik. Das sieht man ja auch im kleinen Österreich: Da wechseln die engsten Politikberater vom Bankensektor in das Kabinett der Minister und wieder zurück. Kritische Wirtschaftswissenschafter haben da keinen Platz. Das Schlamassel um die Hypo-Alpe-Adria ist auch unter diesem Aspekt zu sehen. Auch in der Europäischen Zentralbank kommen die Spitzen aus dem Bankenbereich (Goldman Sachs etc.). Vermutlich braucht man diese Leute auch, aber nicht nur! Einstein sagte einmal: Man kann Probleme nicht mit der Denke lösen, die die Probleme verursacht hat. Sie sehen also kein Licht am Horizont?
Gabriel: Es gibt, zumindest was ich in Europa sehe, durchaus einige Ansätze, die Sinn machen. Ein Beispiel wäre die gemeinsame Bankenaufsicht, die nationale Rücksichtnahmen und Verbandelungen durchbrechen könnte. Nur beobachte ich da, dass man die wichtigen Schritte bei den großen Instituten, etwa die Trennung von Bank- und Spekulationsgeschäften, bisher nicht gemacht hat, dafür aber die kleinen Sparkassen mit einem Wust an bürokratischen Pflichten überrollt; oder auch das Vorgehen der Finanzmarktaufsicht gegen innovative Finanzierungskonzepte, wie sie die Waldviertler Schuhwerkstatt (Heini Staudinger) oder Jugend Eine Welt versuchen. Mir kommt das vor wie bei einem Hausbau, wo man jede Schraube zählt, aber nicht darauf schaut, ob das Haus auch statisch in Ordnung ist. Ein Versuch, die Finanzinstitute stärker in die Pflicht zu nehmen, ist auch die Europäische Bankenunion, wo in einen Haftungsfonds eingezahlt wird – aber auch da scheinen nationale Egoismen schon wieder Löcher zu schlagen. Ein Fortschritt ist auch, dass zumindest elf EU-Länder bereit sind, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, um dadurch nicht nur einen Beitrag der Finanzmärkte zum Gemeinwohl zu lukrieren, sondern auch Zockerpraktiken auf den Finanzmärkten einzudämmen. Sie sprachen von einer notwendigen „NeuDenke“. Wo soll da, auch aus Sicht der Katholischen Soziallehre, angesetzt werden?
Gabriel: Die Soziallehre hat keine Rezepte, aber sie stellt von ihren Grundsätzen her entscheidende Fragen, die Papst Franziskus noch einmal zuspitzt – auch was das Gesamtkonzept der Wirtschaft angeht. Da stellt sich etwa die Frage, wie muss unsere Wirtschaft aufgestellt sein, damit Arbeit, Einkommen und Ressourcen so verteilt werden, dass sie möglichst allen ein „gutes Leben“ ermöglicht? Wie können wir Steuern so steuern, dass sie zu einem – auch demokratiepolitisch wichtigen – gerechten Ausgleich und zur Sicherstellung einer menschenwürdigen Grundversorgung beitragen? Wie können wir unser Sozialsystem sichern, das auf eine durchgängige Voll-erwerbsarbeit setzt, die es immer seltener gibt? Was bedeutet es, wenn die Entwicklung eines Landes nur am Bruttonationalprodukt
gemessen wird und dabei viele Leistungen wie familiäre Kinderbetreuung und Pflege oder Freiwilligen-Arbeit nicht eingerechnet werden? Wo brauchen wir eine innovative und auch risikobereite Finanzwirtschaft und ab wann schadet sie? Die große Herausforderung für die Kirchen sehe ich darin, dass wir uns nicht nur auf der individuellen Ebene für ein gutes Verhalten – etwa die ethische Geldanlage – einsetzen. Wir müssen auch auf der Ebene der Unternehmen für ein neues Geschäftsmodell eintreten und Hilfestellungen geben, damit z. B. ethische Geldveranlagung überhaupt sinnvoll ist. Und wir müssen uns auf der Makroebene, wo es um die Finanz- und Wirtschaftsarchitektur geht, offensiver einmischen und dazu auch Allianzen suchen. http://sozialwortzehnplus.org/
Neue Fragen und bisherige Antworten
Als das Sozialwort der christlichen Kirchen Österreichs 2003 veröffentlicht wurde, war von der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise und den dramatischen Folgen noch keine Rede. Dennoch finden sich im Text Passagen, die im Kontext dieser Krise bedeutsam sind – auch wenn es nun einer „Nachschärfung“ bedarf. „Wo der Markt sich selbst überlassen bleibt, entsteht Ungleichverteilung von Einkommen, Vermögen und Beteiligungschancen. Aufgabe der Politik ist es, durch Bereitstellung einer allen zugänglichen Infrastruktur, durch eine ausgleichende Steuerund Sozialpolitik, durch rechtliche Regelung von Arbeit und Wirtschaft dafür zu sorgen, dass alle Menschen einen gerechten Anteil an den gemeinsam erwirtschafteten Gütern und Leistungen erhalten und menschenwürdig leben können.“ (Nr. 191) „Der Staat ist kein Unternehmen, das allein nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln kann. Politik muss auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Tatsächlich werden politische Entscheidungen allein nach wirtschaftlichen Effizienzkriterien getroffen.“ (Nr. 192) „Die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Österreich prüfen die Möglichkeit, ihr Vermögen vorwiegend in solchen Fonds anzulegen, die in Unternehmen investieren, die ihre Tätigkeit in überprüfbarer Weise nach Umwelt-, Sozialund Menschenrechtskriterien ausrichten.“ (Nr. 201) „Auch Christen und Christinnen sind aufgerufen … in ihren Geld- und Vermögensanlagen auf ethisches
Investment zu achten.“ (Nr. 202) „Die Kirchen treten für ein gerechtes Steuersystem ein, das die Belastung der Erwerbsarbeit verringert, dafür andere Faktoren stärker belastet.“ (Nr. 206)






 Jetzt die
Jetzt die