KOMMENTAR_
Vorwurf: "Staatsfeindlichkeit"

Die Historikerkommission der Republik hat ihre Arbeit abgeschlossen. Untersucht wurde auch der massive Klostersturm der Nazis auf die oö. Stifte.
„Die Kirche war vom Vermögensraub der Nationalsozialisten immens betroffen“, resümiert der Historiker Johann Großruck. Fünf von sieben oö. Stiften entzogen die Nazis sämtliches Vermögen, was einer Auflösung der Stifte gleichkam. Beispielhaft hat er für die oö. Stifte den Vermögensraub und die Restitution nach der NS-Herrschaft im Auftrag der Historikerkommission erforscht.
Mit dem Vorwurf des „volks- und staatsfeindlichen“ Verhaltens, aber auch des „unmoralischen“ oder sogar „unchristlichen“ Lebenswandels der Ordensangehörigen wurde der Vermögensraub begründet. „Das war eine Propagandamasche, um diesen Vernichtungskampf in der Öffentlichkeit argumentieren zu können“, erläutert Großruck. Dies war – anders als bei der Enteignung jüdischer Bürger – notwendig, weil die Kirche in der Bevölkerung verwurzelt war.
Das Vermögen, sämtliche Gebäude, Betriebe, Grundstücke und Kunststücke wurden eingezogen. Die Konventsangehörigen waren ins Exil gezwungen, St. Florian ging beispielsweise nach Pulgarn. Die Nationalsozialisten brauchten die Ressourcen und konnten nicht auf das geplante Vorgehen gegen die Kirche nach dem „Endsieg“ warten.
Beim Stift Schlierbach war den Nationalsozialisten offensichtlich das Vermögen für einen Einzug zu unbedeutend. Wie beim Stift Reichersberg, wo eine Fliegerschule einquartiert wurde, nutzten die Machthaber aber Ressourcen und Räumlichkeiten in enormem Maße. So waren auch diese beiden Stifte, denen die De-facto-Auflösung erspart blieb, stark von den Repressalien betroffen. In allen Stiften wurde in weiterer Folge Raubbau betrieben, so durch die Einquartierung von Massen an Flüchtlingen und „Umsiedlern“. In Schlägl beispielsweise entstanden nachhaltige Schäden durch übermäßige Abholzung des Forstbestandes.
Die Kunstsammlungen der Stifte wurden zentralisiert. Manch großer und kleiner Nationalsozialist bediente sich bei Möbeln und Bildern, um seine Räumlichkeiten repräsentativ zu gestalten. In St. Florian zog die Reichsrundfunkgesellschaft ein, der Intendant bezog die Räumlichkeiten des Abtes. Anlagen, ganze Betriebe und Grundstücke wurden aus den eingezogenen Vermögenswerten der Stifte verkauft. Diese tief greifenden Veränderungen schufen zum Teil große Probleme bei der Rückgabe nach dem Ende des NS-Regimes.
Die amerikanischen Besatzer übergaben zwar sehr schnell den Konventen ihr Vermögen provisorisch zurück, doch damit begann erst die schwierige Aufgabe der Restitution und der Abgeltung des entstandenen Schadens. Bei manchen Kunstwerken waren zur Wiederauffindung detektivische Fähigkeiten notwendig. Für die Rückgabeformalitäten von Kunstwerken aus dem Bundesdenkmalamt mussten die Stifte sogar einen stattlichen Betrag zahlen.
Viele der Schäden konnten gar nicht abgeschätzt werden. Wie sollte man z. B. den durch Abholzung entstandenen Schaden beziffern? Die Stifte einigten sich mit dem Land Oberösterreich, das als Rechtsnachfolger des Gaues Oberdonau zuständig war, auf Abschlagszahlungen.
Für Johann Großruck war die Quantifizierung der Schäden die Schwierigkeit seines Forschungsauftrages. Konnten doch mitunter nicht einmal jene, denen das Vermögen entzogen worden war, den Schaden beziffern. Dem Land Oberösterreich stellt er aber ein positives Zeugnis aus: Man habe für die Verhältnisse der Zeit einen großen Aufwand betrieben, um das Vermögen ermitteln zu können. Trotz Rückstellung und Abschlagszahlungen gingen die Schäden aber letztlich weitgehend zu Lasten der Stifte. Eine Art indirekte Restitution sieht er in den Landesausstellungen. Da wurde viel in die Stifte investiert.
Ganz sicher nicht bezifferbar und in keinster Weise wieder gutzumachen sind die menschlichen Verluste: 116 Ordensangehörige wurden für den Krieg eingezogen, 23 fanden so den Tod. 12 kamen durch Terrormaßnahmen (z. B. Konzentrationslager) um. Die Stiftsangehörigen waren der gesamten Palette des NS-Terrorapparates ausgesetzt. „Das waren die gravierendsten Verluste, nicht das Materielle“, betont Großruck. Und dies gilt für alle Opfer des NS-Regimes.
Infos: www.historikerkommission.at
„Die Kirche war vom Vermögensraub der Nationalsozialisten immens betroffen“, resümiert der Historiker Johann Großruck. Fünf von sieben oö. Stiften entzogen die Nazis sämtliches Vermögen, was einer Auflösung der Stifte gleichkam. Beispielhaft hat er für die oö. Stifte den Vermögensraub und die Restitution nach der NS-Herrschaft im Auftrag der Historikerkommission erforscht.
Mit dem Vorwurf des „volks- und staatsfeindlichen“ Verhaltens, aber auch des „unmoralischen“ oder sogar „unchristlichen“ Lebenswandels der Ordensangehörigen wurde der Vermögensraub begründet. „Das war eine Propagandamasche, um diesen Vernichtungskampf in der Öffentlichkeit argumentieren zu können“, erläutert Großruck. Dies war – anders als bei der Enteignung jüdischer Bürger – notwendig, weil die Kirche in der Bevölkerung verwurzelt war.
Das Vermögen, sämtliche Gebäude, Betriebe, Grundstücke und Kunststücke wurden eingezogen. Die Konventsangehörigen waren ins Exil gezwungen, St. Florian ging beispielsweise nach Pulgarn. Die Nationalsozialisten brauchten die Ressourcen und konnten nicht auf das geplante Vorgehen gegen die Kirche nach dem „Endsieg“ warten.
Schlierbach zu unvermögend
Beim Stift Schlierbach war den Nationalsozialisten offensichtlich das Vermögen für einen Einzug zu unbedeutend. Wie beim Stift Reichersberg, wo eine Fliegerschule einquartiert wurde, nutzten die Machthaber aber Ressourcen und Räumlichkeiten in enormem Maße. So waren auch diese beiden Stifte, denen die De-facto-Auflösung erspart blieb, stark von den Repressalien betroffen. In allen Stiften wurde in weiterer Folge Raubbau betrieben, so durch die Einquartierung von Massen an Flüchtlingen und „Umsiedlern“. In Schlägl beispielsweise entstanden nachhaltige Schäden durch übermäßige Abholzung des Forstbestandes.
Die Kunstsammlungen der Stifte wurden zentralisiert. Manch großer und kleiner Nationalsozialist bediente sich bei Möbeln und Bildern, um seine Räumlichkeiten repräsentativ zu gestalten. In St. Florian zog die Reichsrundfunkgesellschaft ein, der Intendant bezog die Räumlichkeiten des Abtes. Anlagen, ganze Betriebe und Grundstücke wurden aus den eingezogenen Vermögenswerten der Stifte verkauft. Diese tief greifenden Veränderungen schufen zum Teil große Probleme bei der Rückgabe nach dem Ende des NS-Regimes.
Die amerikanischen Besatzer übergaben zwar sehr schnell den Konventen ihr Vermögen provisorisch zurück, doch damit begann erst die schwierige Aufgabe der Restitution und der Abgeltung des entstandenen Schadens. Bei manchen Kunstwerken waren zur Wiederauffindung detektivische Fähigkeiten notwendig. Für die Rückgabeformalitäten von Kunstwerken aus dem Bundesdenkmalamt mussten die Stifte sogar einen stattlichen Betrag zahlen.
Viele der Schäden konnten gar nicht abgeschätzt werden. Wie sollte man z. B. den durch Abholzung entstandenen Schaden beziffern? Die Stifte einigten sich mit dem Land Oberösterreich, das als Rechtsnachfolger des Gaues Oberdonau zuständig war, auf Abschlagszahlungen.
Für Johann Großruck war die Quantifizierung der Schäden die Schwierigkeit seines Forschungsauftrages. Konnten doch mitunter nicht einmal jene, denen das Vermögen entzogen worden war, den Schaden beziffern. Dem Land Oberösterreich stellt er aber ein positives Zeugnis aus: Man habe für die Verhältnisse der Zeit einen großen Aufwand betrieben, um das Vermögen ermitteln zu können. Trotz Rückstellung und Abschlagszahlungen gingen die Schäden aber letztlich weitgehend zu Lasten der Stifte. Eine Art indirekte Restitution sieht er in den Landesausstellungen. Da wurde viel in die Stifte investiert.
Menschen nicht restituierbar
Ganz sicher nicht bezifferbar und in keinster Weise wieder gutzumachen sind die menschlichen Verluste: 116 Ordensangehörige wurden für den Krieg eingezogen, 23 fanden so den Tod. 12 kamen durch Terrormaßnahmen (z. B. Konzentrationslager) um. Die Stiftsangehörigen waren der gesamten Palette des NS-Terrorapparates ausgesetzt. „Das waren die gravierendsten Verluste, nicht das Materielle“, betont Großruck. Und dies gilt für alle Opfer des NS-Regimes.
Infos: www.historikerkommission.at
weitere Artikel zum Themenbereich





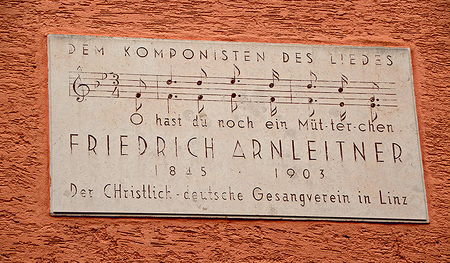
 Jetzt die
Jetzt die