KOMMENTAR_
Kyrie-Litanei
Der besondere Reiz einer Litanei besteht im Wechselgesang des Vorsängers/der Vorsängerin und der unmittelbar antwortenden Gemeinde, sowie in den Wiederholungen, die eine Art von Versenkung ermöglichen. In diesem Fall – „Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld“ (GL 523) – handelt es sich um eine Kyrie-Litanei.
Warum betteln wir „Herr, erbarme dich!“, als ob wir an ihm zweifelten und er sich vielleicht auch „nicht erbarmen“ könnte? Wo uns doch in der Bibel nichts gewisser zugesprochen wird als die göttliche Barmherzigkeit.
Dass die unbedingte Liebe uns ruft samt unserem Schuldig-Werden aneinander und an uns selbst, davon spricht der erste Teil dieser Litanei. Dreimal wird das „Kyrie eleison“ eingewoben und mit der deutschen Version „Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser“ beschlossen.
Der zweite Teil – dem dreimaligen „Christe eleison“ zugeordnet – spricht nun aus, was wir erbitten, und warum wir immer noch und immer wieder dieses „erbarme dich unser“ aussprechen: „Lass uns glauben an deine Liebe“. Weil offenbar nichts schwieriger ist als diese Liebe zu glauben, dieser Liebe zu trauen, sich von dieser Liebe wirklich geliebt zu fühlen.
Der dritte Teil – wieder dreimal vom „Kyrie eleison“ durchzogen –bittet um „Hilfe“, in diesem Glauben an diese Liebe „nicht zu wanken“ und in ihr uns fest zu machen, „was (immer) uns auch zustößt“.
Der insgesamt neunfache Kyrie-Ruf ist melodisch immer gleich. Harmonisch wechselt das Lied zwischen Moll- und Dur-Empfinden – vielleicht als Spiegel der wechselnden Zeiten in unserem Leben: mal wissen wir uns geliebt, und im nächsten Moment schon wieder knechten wir uns und einander mit unserem Ungeliebt-Sein.
„Du machst uns aus Knechten zu Freunden“ ist in allen drei Teilen enthalten. Wenn wir Jesus glauben, dass sein Vater uns liebt, dann werden aus Knechten Freunde, die in gegenseitiger Zugewandtheit ihr eigenes Leben verantworten. Aber sein Erbarmen wird notwendig sein, dass das in uns geschieht.
Warum betteln wir „Herr, erbarme dich!“, als ob wir an ihm zweifelten und er sich vielleicht auch „nicht erbarmen“ könnte? Wo uns doch in der Bibel nichts gewisser zugesprochen wird als die göttliche Barmherzigkeit.
Dass die unbedingte Liebe uns ruft samt unserem Schuldig-Werden aneinander und an uns selbst, davon spricht der erste Teil dieser Litanei. Dreimal wird das „Kyrie eleison“ eingewoben und mit der deutschen Version „Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser“ beschlossen.
Der zweite Teil – dem dreimaligen „Christe eleison“ zugeordnet – spricht nun aus, was wir erbitten, und warum wir immer noch und immer wieder dieses „erbarme dich unser“ aussprechen: „Lass uns glauben an deine Liebe“. Weil offenbar nichts schwieriger ist als diese Liebe zu glauben, dieser Liebe zu trauen, sich von dieser Liebe wirklich geliebt zu fühlen.
Der dritte Teil – wieder dreimal vom „Kyrie eleison“ durchzogen –bittet um „Hilfe“, in diesem Glauben an diese Liebe „nicht zu wanken“ und in ihr uns fest zu machen, „was (immer) uns auch zustößt“.
Der insgesamt neunfache Kyrie-Ruf ist melodisch immer gleich. Harmonisch wechselt das Lied zwischen Moll- und Dur-Empfinden – vielleicht als Spiegel der wechselnden Zeiten in unserem Leben: mal wissen wir uns geliebt, und im nächsten Moment schon wieder knechten wir uns und einander mit unserem Ungeliebt-Sein.
„Du machst uns aus Knechten zu Freunden“ ist in allen drei Teilen enthalten. Wenn wir Jesus glauben, dass sein Vater uns liebt, dann werden aus Knechten Freunde, die in gegenseitiger Zugewandtheit ihr eigenes Leben verantworten. Aber sein Erbarmen wird notwendig sein, dass das in uns geschieht.
weitere Artikel zum Themenbereich





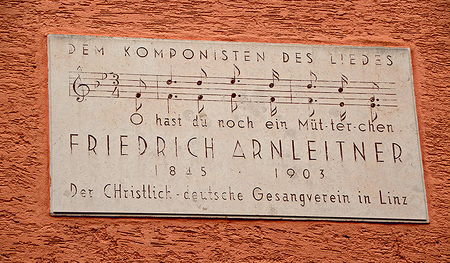
 Jetzt die
Jetzt die