In der Reihe Kunst & Geschichte_n stellt Experte Lothar Schultes Persönlichkeiten vor, die in Kunst und Geschichte wichtige Spuren in Oberösterreich hinterlassen haben.
Die abschlossene Reihe "alt & kostbar" finden sie hier.
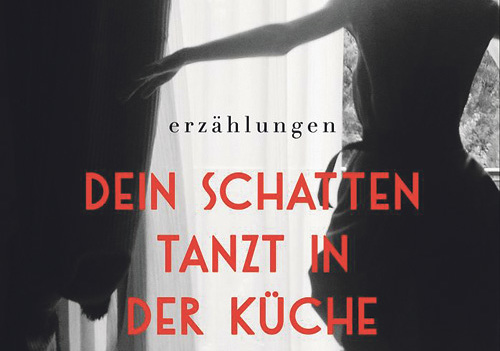
Vom Scheitern – also vom echten Leben – handeln die fünf Erzählungen in Barbara Frischmuths neuem Buch. Es geht um fünf Frauen, die mit unterschiedlichen, jedenfalls aber schwierigen Herausforderungen umgehen müssen und darin ihr Bestes geben. Da ist z.B. Agnes, die zur Großmutter wider Willen wird, oder Darya, die nur durch Flucht einer Zwangsheirat entgeht, aber dann mit einem schweren Verrat leben muss. Oder Amelie, eine siebzigjährige Schauspielerin, der die Berühmtheit versagt war, die vom Schicksal gebeutelt in prekären finanziellen Verhältnissen lebt, aber sich trotzdem nicht unterkriegen lässt, nicht einmal vom Alter. Paula, die aus der Stadt zu ihrem Mann aufs Land zieht, sich um Haus, Tiere und Stiefsohn kümmert und dabei ihre Selbstständigkeit und Originalität bewahrt. Und Doris, die sich von ihrem dominanten Verlobten befreit und beruflich so lange sucht, bis sie „das Richtige“ findet.
Barbara Frischmuth beschreibt ihre (Anti-)Heldinnen und ihre an Dramatik reichen Lebensläufe in einer klaren, geradezu lakonischen Sprache und mit zuweilen fast schmerzhafter emotionaler Distanz. Möglicherweise schafft gerade das vielerlei Identifikationsmöglichkeiten.
Barbara Frischmuth: Dein Schatten tanzt in der Küche.
Berlin: Aufbau Verl. 2021, 222 S., € 20,10
Ebenfalls in diesem Frühjahr hat der Residenzverlag in seiner Reihe „Unruhe bewahren“ einen hochinteressanten Essay der ausgewiesenen Naturkennerin und Gärtnerin Frischmuth herausgebracht, in dem sie aufzeigt, wie Natur im Alltag, in Literatur, Kultur und Wissenschaft zur Sprache kommt.
Barbara Frischmuth: Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen. Wien-Salzburg: Residenzverlag 2021, 72 S., € 18,–
Es ist die Geschichte ihrer Eltern, die Ljuba Arnautovi´c in ihrem zweiten Roman „Junischnee“ erzählt. Karl ist neun Jahre alt, als er 1934 von seiner Mutter Eva, einer Kommunistin und Angehörigen des Österreichischen Schutzbundes, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Slavko in die Sowjetunion geschickt wird, um sie vor den Nationalsozialisten in Sicherheit zu bringen. Zunächst erwartet die Buben ein angenehmes Leben in einem Kinderheim in Moskau mit Ferien auf der Krim.
Doch die Weltgeschichte wendet ihr Schicksal. Als Hitler den Pakt mit Stalin bricht und die Deutschen die Sowjetunion überfallen, werden die Buben zu „Volksfeinden“ und als solche in ein Arbeitslager gesteckt. Die Fluchtversuche der beiden scheitern. Slavko verschwindet für immer. Karl lernt in einem solchen Lager seine Frau Nina kennen, die Mutter der Autorin. Nach der Haft – Karl wird 1953 entlassen – zieht es ihn zurück nach Wien. Drei Jahre später kann die Familie ausreisen. Nina jedoch gelingt es nicht, in der Fremde heimisch zu werden. Sie geht schließlich zurück zu ihrer Mutter nach Kursk. Aus dem erwarteten Glück wachsen neue Probleme und persönliche Katastrophen, vor allem ein erbitterter Kampf um die Kinder.
Ljuba Arnautovi´c schildert in ihrem zweiten Roman die wechselhafte Geschichte zweier Menschen, die durch politische Umstände, Willkür und Grausamkeit traumatisiert und um ihre Jugend gebracht worden sind. Sie tut das unter Zuhilfenahme von Briefen und historischen Dokumenten wie Verhörprotokollen und unter Verwendung einer klaren, nüchternen Sprache, die Leser/innen viel Raum lässt zum Nachdenken über die Verhältnisse in ihrer ganzen Grausamkeit.
Ljuba Arnautovi´c: Junischnee.
Zsolnay: Wien 2021, 188 S., € 22,70
Was macht einer, wenn der 60. Geburtstag vor der Tür steht, er aber keinesfalls alt werden will und schon gar nicht gefeiert? Jeder, der nicht vorher stirbt, steht eines Tages vor dieser Frage. Jakob Thurner, der Ich-Erzähler in Norbert Gstreins neuem Roman, schickt sich an, eine Lebensbeichte abzulegen. Er ist ein Schauspieler, der es in den USA durch Rollen als Bösewicht, mehrmals als Frauenmörder, zu lokaler Berühmtheit gebracht hat. Wie der Autor stammt er aus den Tiroler Bergen. Anlass, in sich zu gehen, ist die Frage seiner über alles geliebten Tochter Luzie, was denn das Schlimmste sei, das er in seinem Leben getan habe. Und dann sagt sie ihm nach der Lektüre des Manuskripts einer Biografie, die zu seinem Geburtstag erscheinen soll, auch noch, dass er darin als „blasser Zeitgenosse“ erscheine. Das ist schlimm, denn Jakob ist eitel. Doch die geplante Biographie und vor allem deren Verfasser hasst er sowieso. Jakobs Einladung, mit ihm nach Amerika zu fahren, schlägt Luzie zu seiner großer Enttäuschung aus. Er muss sich also allein auf die Reise an die mexikanische Grenze der USA begeben, die schließlich eine Reise zu sich selbst wird.
Eine Gewissenserforschung um die Fragen von Schuld und Scham, aber auch Rechtfertigung, von Identität, menschlichen Abgründen und Lebenslügen, bei der der Boden der Gewissheiten immer stärker ins Wanken gerät und die Unterscheidung von Fakten und Fiktion zunehmend mehr verschwimmt. Erst nach über 400 Seiten kommt es zu einer Begegnung mit dem ersten Jakob, von dem bereits auf den ersten Seiten die Rede ist. Der in der Familie geduldete Sonderling ist ein Onkel des Protagonisten, mit dem ihn durchaus einige
Eigenheiten verbinden und der bereits seit über
80 Jahren im familieneigenen Hotel lebt. – Diesem Onkel Jakob hat Norbert Gstrein übrigens in seinem ersten Buch „Einer“ bereits 1988 ein berührendes Denkmal gesetzt.
„Der zweite Jakob“ ist ein vielschichtiges, schwieriges Buch, das vor allem sprachlich ein besonderes Leseerlebnis bietet.
Norbert Gstrein: Der zweite Jakob. München: Carl Hanser 2021, 441 S., € 25,70
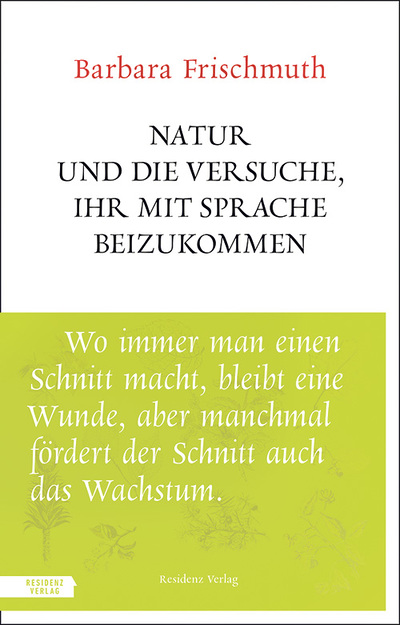
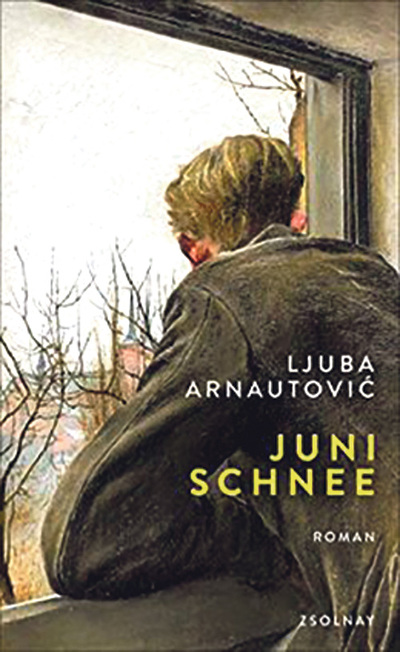
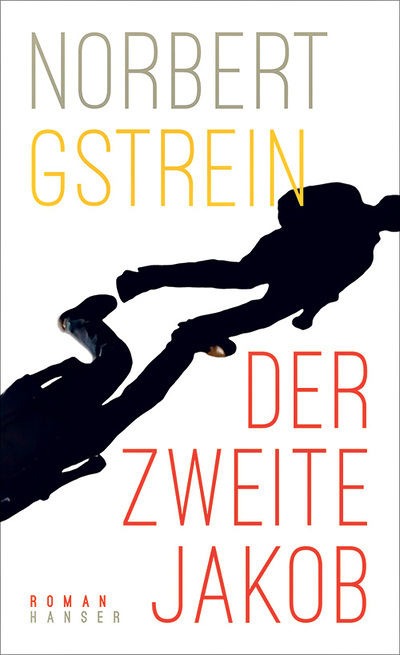
In der Reihe Kunst & Geschichte_n stellt Experte Lothar Schultes Persönlichkeiten vor, die in Kunst und Geschichte wichtige Spuren in Oberösterreich hinterlassen haben.
Die abschlossene Reihe "alt & kostbar" finden sie hier.
BÜCHER_FILME_MUSIK
 KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
MEIST_GELESEN