Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.
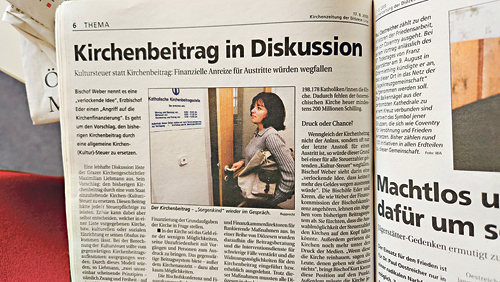
Jede steuerpflichtige Person sollte die Kirchen-(Kultur-)Steuer leisten. Sie dürfte dabei selbst entscheiden, in welcher Kirche oder sozialen bzw. kulturellen Einrichtung sie den Beitrag entrichten möchte. Für die Kirche wäre die Kultursteuer vorteilhaft, erklärte Liebmann: „Der Vorteil für die Kirchen wäre der Wegfall finanzieller Anreize für den Kirchenaustritt und die Bewältigung wachsender Finanzierungsprobleme, die auch durch die Erhaltung von allen zugutekommenden Kulturdenkmälern entstehen.“
Liebmanns Vorschlag der Kultursteuer war aber nicht neu. Fünf Jahre davor hatte es eine Unterschriftenaktion von „Reformkreisen“ gegeben. Dennoch gab es Zweifel, ob der Kirchenbeitrag abgeschafft werden sollte. Im Rahmen einer Studientagung der Bischofskonferenz und Finanzkammerdirektoren entschied man sich – wie nicht anders zu erwarten – für die Beibehaltung des Kirchenbeitrags.
Für die Diözesen wurden flankierende Maßnahmen festgelegt: „Trotz dieser Maßnahmen mussten alle Diözesen Sparprogramme einleiten, da die Ausgaben den Einnahmen davonzulaufen drohten“, schrieb die Kirchenzeitung. Ein wesentlicher Grund, der dazu führte, waren die hohen Kirchenaustritte. 1995 traten 198.178 Katholik:innen aus der Kirche aus. Dadurch fehlten der Kirche im Jahr 2000 ungefähr 200 Mio. Schilling, etwa 14 Mio. Euro. Die Meinungen zum Kirchenbeitrag waren vielfältig. Bischof Weber, der der Finanzkommission der Bischofskonferenz angehörte, und der ehemalige Präsident der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV), Johannes Martinek, waren an der Debatte interessiert. Beide waren der Meinung, dass die Kultursteuer vor Kirchenaustritten bewahren könnte.
Sozialratgeber
Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.
Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>
 Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>