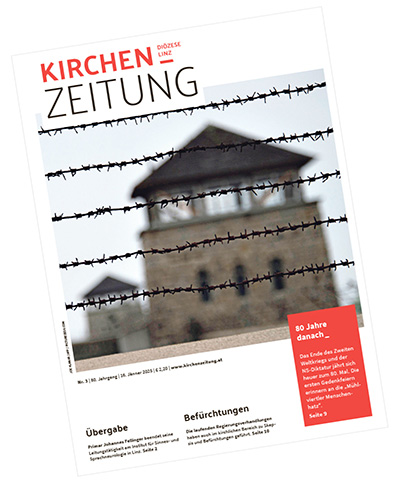
Gewalt darf sich nicht lohnen

Herr Dr. Herzog, wann fängt Gewalt eigentlich an?
Rupert Herzog: Gewalt ist ein mehrdeutiges Phänomen. Wenn ein Mensch zuschlägt oder den Abzug einer Waffe drückt, dann kann das eine verabscheuungswürdige, traumatisierende Gewalttat sein, aber auch als Abwehr, Notwehr oder aufopfernde Handlung verstanden werden. Ich denke, Gewalt fängt dann an, wenn eine Tat Leid verursacht, wenn sie zwischenmenschliche Beziehungen zerstört, wenn eine bewusst schädigende Absicht dahintersteht, wenn sie der Herrschaft, der Macht, der Kontrolle, der Unterdrückung dient. Das lässt immer noch vieles offen, aber es geht mir um die Intention, die dahinter steht. Die Absicht ist nicht auf den ersten Blick sichtbar, deshalb ist es wichtig, auf die möglichen Ursachen zu schauen. In der Arbeit mit gewalttätigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen müssen wir uns immer fragen, welche Gründe sie für ihr Handeln haben. Das heißt nicht, dass man mit ihnen übereinstimmt. Aber erst dann können wir Veränderungen bei Gewalttätern und in gesellschaftlichen Strukturen, die zu Gewalttaten führen, bewirken.
Welche Rolle spielen Elternhaus und Schule beziehungsweise sozialer oder wirtschaftlicher Druck, wenn Menschen gewalttätig werden?
Herzog: Wir unterscheiden in der Gewaltforschung zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gewalttätig wird. Schutzfaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Gewalt ablehnt. Familie und Kindheit haben dabei unglaublich große Auswirkungen. Der wichtigste Risikofaktor ist selbst erlittene, erlebte oder beobachtete Gewalt. Je früher in der Kindheit das stattfindet, umso nachhaltiger ist es. Der wesentliche Schutzfaktor ist eine sichere Beziehung. Erwachsene haben hier Vorbildwirkung. Wenn wir einander respektvoll und wertschätzend begegnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder respektvoll miteinander umgehen, sehr hoch. Auch die sozialökonomische, also gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation hat einen zentralen Einfluss. Dabei geht es nicht darum, ob ein Land arm oder reich ist, sondern darum, wie groß der Unterschied zwischen der relativen Armut und dem Reichtum ist. Das hat unmittelbare Auswirkungen unter anderem auf die Häufigkeit von Gewalt. Wir brauchen eine Politik der Anerkennung, die ermöglicht, dass sich alle Menschen zugehörig fühlen und Zukunftschancen haben. Perspektivlosigkeit ist gewaltfördernd. Ich befürchte, da kommen einige Herausforderungen auf uns zu.
Im Zusammenhang mit Gewalt und Mobbing in der Schule sprechen Sie von einer „Kultur des Eingreifens“. Hat das mit Zivilcourage zu tun?
Herzog: Eingreifen ist Zivilcourage, der Mut der Bürgerinnen und Bürger, gegen Gewalt aktiv zu werden. Gewalt ist kein Schickssalsschlag, sondern sie wird ermöglicht. Wir unterscheiden zwischen der Gruppe der Gewalttäter, jener der von Gewalt Betroffenen und der dritten Gruppe der Ermöglicher, der Zuschauer, Wegschauer, Mitmacher, Mitlacher, Verharmloser, Tabuisierer. Im Wesentlichen wird Gewalt durch die Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt ermöglicht. Es geht darum, zu einer Verantwortungsübernahme zu kommen, sodass sich jede und jeder die Frage stellt: „Was kann ich dazu beitragen, dass es nicht zu Gewalt kommt?“ Dazu braucht man zivilen Mut. Solange wir ein Bild davon haben, dass ein „richtiger Mann“ der ist, der zuschlägt, werden wir nicht erfolgreich gegen Gewalt sein können. Ein richtiger Mann nützt seine Kraft für Schwächere, er nützt sie für Fürsorge.
Wie kann Gewalt beendet werden?
Herzog: Ich würde es nicht so formulieren, denn ich vermute, es wird keine Gesellschaft ohne Gewalt geben. Es geht darum, wie wir dafür sorgen können, dass Gewalt weniger wird. Ein Punkt dabei ist: Gewalt darf sich für jene, die Gewalt ausüben, nicht mehr lohnen. Wir müssen in allem, was wir tun, darauf achten, dass wir die Menschenrechte durchsetzen, dass wir jeden Menschen als Individuum und zugleich als Teil der Menschheit sehen. Jeder Mensch hat seinen Namen, seine Geschichte, seine himmlischen und höllischen Anteile. Das verbindet uns. Wir brauchen die Freiheit von Furcht. Eine Politik der Angst fördert Gewalt. Und es geht um Mitgefühl, mit anderen Menschen und auch mit der Natur.«








 Jetzt die
Jetzt die