
Fachwissen und Empathie

Auf der Intensivstation werden nicht nur Corona-Patient/innen behandelt, sondern etwa auch Schwerverletzte nach Unfällen, Personen, die eine große Operation hinter sich haben oder aufgrund eines akuten Herzinfarkts oder Schlaganfalls versorgt werden müssen. Fachärzte aus den verschiedensten Bereichen wie Anästhesie, Chirurgie, Kardiologie, Neurologie oder Kinder- und Jugendmedizin arbeiten hier eng zusammen, unterstützt von speziell ausgebildeten Intensivpflegekräften.
Isabella Sparber ist eine davon, sie ist Teil des Teams auf der Internen Intensivstation am Klinikum Wels-Grieskirchen. In einem durchschnittlichen Jahr ohne Corona werden an beiden Klinikumstandorten mehr als 25.000 Operationen und 1.400 Intensivpatient/innen betreut. „Die Vielseitigkeit unseres Aufgabengebietes ist ein Faktor, warum ich mich für die Spezialisierung in der Intensivpflege entschieden habe“, sagt Sparber.
Abwechslungsreiche Tätigkeit
Spannend sei für Sparber vor allem die Betreuung von schwerkranken Patient/innen, welche abhängig von Beatmungsmaschinen sind, hämodynamisches Monitoring (Überwachung des Blutflusses in den Blutgefäßen, Anm.) oder eine maschinelle Unterstützung der Nieren benötigen. „Um die Patient/innen gut zu versorgen, sind technisches Fachwissen, Fehlerdiagnose, praktisches sowie theoretisches Wissen notwendig. Zudem spielt die Angehörigenbetreuung eine wesentliche Rolle“, sagt Sparber.
Viel Abwechslung brächten die Patient/innen selbst in ihren Arbeitsalltag: „Sie alle sind unterschiedlich in ihrem Charakter und ihrer kulturellen und sozialen Prägung. Dies zeigt sich vor allem bei der Entwöhnung von der maschinellen Beatmung. Hier spielt die Pflege eine wichtige Rolle, denn für die Patient/innen ist das eine sehr anstrengende und psychisch belastende Zeit.“
Nach einem wochen- oder monatelangen Aufenthalt sei es nur verständlich, dass Bewältigungsmechanismen nicht mehr greifen würden. „Hier braucht es Empathie, Verständnis und Ehrlichkeit seitens der Pflege, um zu motivieren und Hoffnung zu geben.“
Resilienz
Der Alltag auf einer Intensivstation sei nicht immer einfach, sagt Sperber: „Man braucht Resilienz und muss mit schwierigen Situationen umgehen können, sonst besteht die Gefahr, dass einem der Alltag langfristig zu nahe geht oder man umgekehrt emotional abstumpft.“ In dieser Hinsicht hätten die letzten zwei Jahre durchaus ihre Spuren hinterlassen: „Am Anfang der Coronapandemie habe ich in einem Krankenhaus in England gearbeitet. Diese Zeit hat mir enorm viel Kraft abverlangt. Aber auch die letzten zwei Jahre in Österreich haben mir gezeigt, wie sehr wir von gesundheitspolitischen Entscheidungen abhängig sind.“
Für zukünftige Kolleg/innen wünsche sie sich, dass diese sich voll auf die einjährige Intensivpflege-Sonderausbildung konzentrieren und diese ohne Zusatzdienste absolvieren können.«




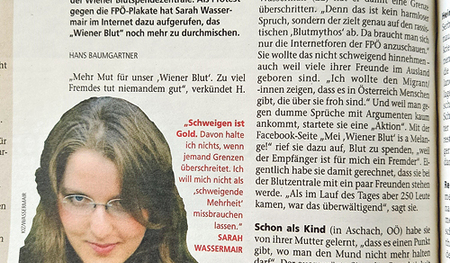


 Jetzt die
Jetzt die