
Das EU-Parlament ist kein Papiertiger mehr

Am 26. Mai findet die Europawahl statt. Was wählen wir da eigentlich genau?
Andreas Müller: Ende Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger aller EU-Staaten ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament. Europaweit werden insgesamt 705 Abgeordnete gewählt, 19 davon in Österreich – vorausgesetzt, Großbritannien wählt wie geplant nicht mehr mit.
Wie funktioniert das Europäische Parlament? Spielen die österreichischen Abgeordneten dort überhaupt eine Rolle?
Müller: Das Europäische Parlament ist, wie andere Parlamente auch, nach politischen Gruppierungen organisiert: den Fraktionen. Die österreichischen Abgeordneten sitzen daher im Plenarsaal des Parlaments nicht nebeneinander, sondern in ihren jeweiligen Fraktionen. Wenn das Parlament seine Position zu einem Thema festlegt – zum Beispiel in Fragen der Klimapolitik, des Datenschutzes oder der Asylpolitik –, bestimmt jede Fraktion ein Mitglied, um die Fraktionsposition in der parlamentarischen Meinungsbildung zu vertreten. So sprechen die österreichischen Abgeordneten bei den von ihnen verantworteten Themen je nach Größe der Fraktion, der sie angehören, für Dutzende, ja hundert oder zweihundert Abgeordnete.
Aber haben in der EU nicht andere das Sagen? Die Regierungen? Die Kommission?
Müller: Am Anfang der europäischen Integration war das Parlament tatsächlich eine Randerscheinung. Es hat sich aber über die Jahrzehnte immer mehr an Zuständigkeiten und Einfluss erarbeitet. Heute ist das Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat – der sich aus den Vertreter/innen der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammensetzt – bei fast allen Themen gleichberechtigter Mitgesetzgeber. Das bedeutet, dass Gesetzgebung auf EU-Ebene gegen den Willen des Parlaments nicht möglich ist. Dazu kommt, dass das Europäische Parlament auch den Präsidenten oder die Präsidentin der Kommission wählt und damit entscheidenden Einfluss auf die Spitze der europäischen „Regierung“ hat. Natürlich findet die Meinungsbildung im Europäischen Parlament nicht im kräftefreien Raum statt. Hier gibt es politischen Druck von Mitgliedstaaten und Kommission. Will das Parlament ihm wichtige Anliegen durchbringen, muss es Zugeständnisse machen.
Und wie ist das mit den Lobbyisten?
Müller: Verschiedenste Interessengruppen versuchen die Meinungsbildung im Europäischen Parlament zu beeinflussen. Das ist grundsätzlich ganz normal und wichtig, da so auch viel an Fachwissen in den Gesetzgebungsprozess einfließt und die Abgeordneten sich ein Bild über die politischen Anliegen dieser Gruppen machen können. Das muss also kein Gegensatz zur Bürgernähe sein. Es kann dabei aber auch zu einer Schieflage kommen, die gewissen Gruppen übermäßig viel Einfluss verschafft. Das ist mit dem eher negativ besetzten Begriff „Lobbying“ gemeint, und davor ist auch und gerade das Europäische Parlament nicht gefeit. Seit einigen Jahren gibt es aber ein „Transparenzregister“, in das sich Lobbyisten – im Moment noch auf freiwilliger Basis – eintragen. Gerade das Parlament bemüht sich darum, dass eine Eintragung ins Register verpflichtend wird.
Sind bei der Europawahl große Veränderungen zu erwarten?
Müller: Bislang sind die beiden stärksten Fraktionen jene der Europäischen Volkspartei und der Sozialdemokraten. In vielen EU-Staaten beobachten wir aber eine massive Umgestaltung der politischen Landschaft, und das wird sich auch in der Zusammensetzung des neu gewählten Europäischen Parlaments niederschlagen. Besonders wichtig ist die Frage, wie sich der Einfluss der europakritisch bis europafeindlich eingestellten politischen Gruppierungen entwickelt. Viele sprechen jedenfalls schon von einer „Schicksalswahl“ für Europa. Letztlich ist aber entscheidend, was für jede Wahl gilt: Nur wenn man vom Wahlrecht Gebrauch macht, kann man europäische Demokratie aktiv mitgestalten. Man kann sich jedenfalls nicht damit aus der Verantwortung stehlen, dass man das Europäische Parlament als Papiertiger abtut. Diese Zeiten sind lange vorbei.
Viele haben den Eindruck, die EU ist vom Leben der Menschen zu weit weg. Stimmt das?
Müller: Die EU ist heute so alltagsrelevant, dass man mit dem Aufzählen gar nicht fertig wird: Das fängt mit dem Euro an. Wir genießen durch die EU ganz selbstverständlich Reisefreiheit in Europa. Die EU ist hauptverantwortlich für die Sicherheit unserer Nahrungsmittel ebenso wie für den Schutz unserer Daten. Die EU engagiert sich im Bereich des Verbraucherschutzes, zum Beispiel bei der Deckelung von Roaminggebühren bei Handyverträgen oder bei dem Ausbau von Passagierrechten im Bahn- und Flugverkehr. Dass im Rahmen der EU auch über Beibehaltung oder Abschaffung der Sommerzeit entschieden wird, ist für Europa schon fast wieder zum Bumerang geworden – wie Bananenkrümmungsradien und dergleichen.
Ist die Europawahl auch für Menschen außerhalb der EU wichtig?
Müller: Die EU ist einer der wichtigsten politischen und vor allem wirtschaftlichen Akteure auf dem Planeten. Welche Regeln die EU für sich festlegt, hat unmittelbare Auswirkungen auf andere Regionen der Welt und auf viele Millionen von Menschen. Man denke nur an die Außenhandels- und Landwirtschaftspolitik, an die Entwicklungszusammenarbeit, an die Umwelt- und Klimapolitik oder an die Asyl- und Migrationspolitik.
25 Jahre nach der Volksabstimmung


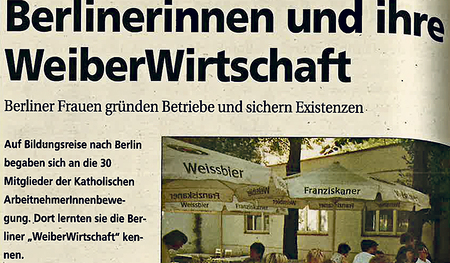





 Jetzt die
Jetzt die