
Die Verfassung ist keine Schönheit, aber tragfähig

Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ Wer es gerne nüchtern und zielstrebig hat, der wird dem ersten Artikel des Bundesverfassungsgesetzes (B-VG) Schönheit und Eleganz attestieren. In Artikel zwei folgt dann aber schon die erste Aufzählung, nämlich jene der Bundesländer. Zum Vergleich: Das deutsche Grundgesetz, das vergangene Woche seinen 70. Geburtstag feierte, hat eine Präambel („im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“) und beginnt mit den Grundrechten („Die Würde des Menschen ist unantastbar.“) Österreichs B-VG ist in weiten Teilen ein „technischer“ Text, der Aufgaben zuweist und Grundregeln für das politische Agieren enthält. „Spielregelverfassung“ nennt man das. Vom „heiligen“ Text einer staatlichen Zivilreligion hat das B-VG fast nichts. „In manchen Teilen und gerade in denen, die in der aktuellen Situation so relevant sind, ist das B-VG in einer verständlichen und klaren Sprache gehalten. Aber für die Verfassung als Ganzes gilt das überhaupt nicht“, sagt Theo Öhlinger, emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Wien.
Keine Staatskrise
Aber kommt es darauf an? Ist es nicht viel wichtiger, dass die Verfassung funktioniert, gerade in politischen Krisen? Beginnt eine „Staatskrise“, wenn man nicht mehr innerhalb der Verfassung agieren (kann)? „Ich würde mit dem Wort ‚Staatskrise‘ nicht so locker umgehen“, mahnt Verfassungsexperte Öhlinger. „Was in Österreich derzeit passiert, ist auch in anderen europäischen Staaten schon geschehen – und diese Staaten sind nicht zusammengebrochen.“
Tatsache ist, dass auch die Ablehnung der zunächst bestellten Übergangsregierung durch das Parlament keine Verfassungskrise zur Folge hat: Der Bundespräsident muss einen neuen Bundeskanzler ernennen, der eine neue Regierung vorschlägt. Für wirklich absolute Notfälle gäbe es übrigens noch ein Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten in Artikel 18 des B-VG, aber hier winkt Öhlinger vehement ab: „Dafür besteht überhaupt kein Anlass. Bundespräsident Van der Bellen hat das auch nicht angedeutet. Im Übrigen ist diese Regelung derart eingeschränkt, dass sie kaum anwendbar ist.“
Ursprünge
Österreichs Bundesverfassungsgesetz (B-VG) ist – wenn auch mit der Unterbrechung von 1934 bis 1945 – eine der ältesten Verfassungen Europas. Um die mangelnde Schönheit des österreichischen Verfassungsrechts verstehen zu können, muss man in die Zeit der Entstehung des B-VG zurückgehen: Als es 1920 in Kraft trat, war es für viele nur ein Provisorium. „Die Mehrheit der Politiker damals wollte einen Anschluss an Deutschland, deshalb hat man sich damit zufrieden gegeben, wesentliche Teile der Verfassungsthemen nur provisorisch zu lösen. Das hat man nicht als tragisch empfunden, weil das kein Text für die Ewigkeit sein sollte“, erklärt Öhlinger. Daraus resultiert auch die Tatsache, dass Österreich keine Verfassung in einem einzelnen Dokument hat. Das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) ist im Grunde nicht mehr als der Kern der Verfassung. Es gibt darüber hinaus über 60 weitere Verfassungsgesetze und zahlreiche Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen.
Gut zeigen lässt sich die Zersplitterung an den Grundrechten, also jenen Rechten, die unter anderem den Freiraum des Bürgers gegenüber dem Staat festlegen (Recht auf Leben, auf persönliche Freiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit usw.). Da sich die Verfassungsschöpfer 1920 nicht auf einen Grundrechtekatalog einigen konnten, wurde fast unverändert das entsprechende Staatsgrundgesetz von 1867, also aus der Monarchie, beibehalten. Nur wenige Grundrechte stehen daher direkt im B-VG, wie etwa der Gleichheitssatz in Artikel 7 (siehe Zitat rechts). Dazu kam nach dem Zweiten Weltkrieg die Europäische Menschenrechtskonvention, die Verfassungsrang hat. Für Belange der EU ist auch deren Grundrechtcharta relevant. Und dann gibt es noch Grundrechte in einzelnen Gesetzen wie dem Datenschutzgesetz. Minderheitengrundrechte leiten sich zudem aus dem Vertrag von Saint Germain und dem Staatsvertrag 1955 ab. Jusstudenten müssen zunächst einmal lernen, wo man was findet.
Reformbemühungen
Versuche, die Verfassung insgesamt übersichtlicher zu machen, gab es natürlich. Zu nennen ist besonders der Österreich-Konvent (2003 bis 2005), an dessen Ende auch ein Entwurf für eine neue Verfassung stand. „Doch zu diesem Zeitpunkt war die Bereitschaft zu grundlegenden Reformen unter den Parteien schon vorbei“, erinnert sich Theo Öhlinger, der Mitglied des Konvents war. Immerhin gelang es 2008, mehr als tausend Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen zu bereinigen. Ein weiteres großes Problem der österreichischen Verfassung ist für Öhlinger der umfangreiche Föderalismus mit seiner komplizierten Aufteilung von Kompetenzen zwischen dem Bund und den Ländern. Auch die eben abgetretene Koalition steckte mit dem Versuch einer Teilbereinigung fest.
Rolle des Bundespräsidenten
Nicht ohne historische Ironie ist es, dass das in der aktuellen Situation mögliche Management der politischen Probleme durch den Bundespräsidenten auf die große Verfassungsveränderung von 1929 zurückgeht: Diese war lange Zeit umstritten, weil sie unter den Vorzeichen autoritärer Strömungen stattfand. Bis dahin wurde die Regierung nämlich vom Parlament gewählt. Die Ernennung des Bundeskanzlers und auf dessen Vorschlag der Regierung durch den Bundespräsidenten wurde erst 1929 eingeführt. Man stelle sich vor, das Parlament müsste in der aktuellen Situation die Regierung wählen! „Der 1929 mühsam errungene Kompromiss ist letztlich positiv zu bewerten“, sagt auch Theo Öhlinger. Entscheidend sei heute, dass die Verfassung im Wettstreit der Parteien außer Streit steht, wie das bisher in der Zweiten Republik der Fall war. Denn „eine Verfassung kann keine Probleme lösen, wenn sie nicht von der grundsätzlichen Zustimmung einer breiten Mehrheit getragen wird.“
Solchen Überlegungen liegt auch die Idee eines Verfassungspatriotismus zugrunde, wie ihn unter anderem der Philosoph Jürgen Habermas vertritt. Aber geht das auch mit der österreichischen Bundesverfassung? „Angesichts der Zersplitterung wird man schwer Begeisterung erwecken können. Für den Staatsbürger ist die Verfassung insgesamt leider kaum mehr lesbar“, sagt Verfassungsjurist Öhlinger. Er würde sich dennoch wünschen, dass ihr 100-Jahr-Jubiläum 2020 gefeiert wird: „Alles, was die Bundesverfassung im Bewusstsein der Bevölkerung verankert – so schwierig das auch ist – ist gut. Wenn man Details auch kritisieren kann, so ist die Verfassung doch in ihrer Gesamtheit die Basis unseres demokratischen und rechtsstaatlichen Gemeinwesens.“






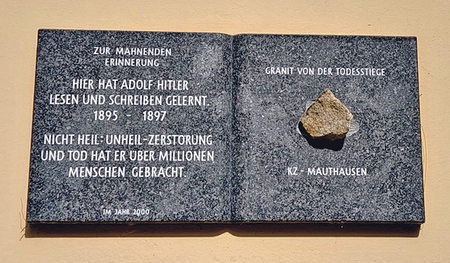

 Jetzt die
Jetzt die