
Zwentendorf im Strahlenglanz

Allahu akbar – Gott ist am größten“, schallt es aus der Kantine im AKW Zwentendorf (NÖ). Es ist Freitagmittag und die Besucher/innen warten das Ende des Gebets einiger Muslime ab, um die Führung durch das Kraftwerk zu beginnen. Die betenden Männer gehören einer ausländischen Delegation an, die wie viele andere zu Schulungszwecken hierher kam: Denn in dem weltweit einzigen fertig gebauten Atomkraftwerk, das nie in Betrieb ging, kann man Orte betreten, die anderswo wegen der Strahlung unzugänglich wären. Das zieht an diesem Freitag auch Interessierte an, die an den Führungen des Energieunternehmens EVN, welches das Areal 2005 gekauft hat, teilnehmen. In der Gruppe sind jüngere Menschen, die sich einen einzigartigen Ort ansehen möchten; und ältere, welche die Debatten um die Inbetriebnahme miterlebt haben. Für sie ist der Eintritt in den Kraftwerkskomplex ein Schritt in die Vergangenheit: Dort hängt die alte Arbeitskleidung, da stehen Telefone im Stil der 1970er Jahre. Die Anlage ist gut erhalten. Nur das Auftreten von Kondenswasser ist offenbar unvermeidlich.
Demonstrationen. Mit Wasser wurde in Zwentendorf einst Elisabeth Sallinger-Leidenfrost bespritzt. Sie war im Sommer 1978 dort, um gegen die AKW-Inbetriebnahme zu demonstrieren. „Die Stimmung unter uns Demonstranten war gut. Es war sehr heiß und die Ortsansässigen haben uns mit Wasser Abkühlung verschafft“, erzählt sie. Die damals 23-jährige Theologiestudentin hatte auch einen persönlichen Grund, gegen Zwentendorf zu demonstrieren: In der Nähe ihres Elternhauses, in St. Pantaleon (NÖ), hätte ein weiteres AKW gebaut werden sollen. Ihre Eltern, die eine Landwirtschaft betrieben, waren auch gegen die Nutzung der Atomkraft aktiv.
Die andere Seite
Ganz sicher für die Inbetriebnahme des Reaktors waren damals jene rund 200 Mitarbeiter, die sich zum Teil jahrelang auf die Arbeit vorbereitet und ihre Zukunft darauf aufgebaut hatten. Auch das gehört zu dieser Geschichte. Die verwaisten Arbeitsplätze sind bei der Führung zu sehen: Hier hätte jemand die Brennstäbe gelagert, dort einen Kran oberhalb des Reaktors bedient, in der Zentrale mit den vielen Schaltern die Anlage überwacht. Die stillstehende Uhr dort zeigt fünf Minuten vor zwölf.
Bildlich gesprochen stand das AKW 1978 genau so knapp vor der Inbetriebnahme. Die Brennelemente waren im Werk, als sich die Politik zur Volksabstimmung entschloss. Laut Umfragen wollten nur 25 Prozent sicher mit Nein stimmen, wie sich Heinz Stockinger erinnert. Der spätere Obmann und Sprecher der Plattform gegen Atomgefahren rechnete zwar mit wachsender Skepsis der Bevölkerung, aber mit bestenfalls 40 Prozent gegen die Inbetriebnahme. „Der Pro-Zwentendorf-Block, dem wir gegenüberstanden, war gigantisch: die Regierung, die Interessenvertretungen, die großen Medien und andere. Es muss an der Information und an der Art der Vermittlung gelegen haben, dass innerhalb von viereinhalb Monaten so viele zum Nein umschwenkten“, sagt Stockinger.
Politik
Es gab auch eine politische Komponente: Die ÖVP trat (wie die FPÖ) im Parlament gegen die Inbetriebnahme auf: offiziell wegen konkreter Sicherheitsbedenken; inoffiziell um den Rücktritt des SPÖ-Alleinregierungskanzlers Bruno Kreisky zu erreichen (was misslang). Mit grundsätzlicher Gegnerschaft zur Atomenergie hatte das wenig zu tun. Bis heute wird argumentiert, dass das knappe Nein bei der Volksabstimmung ohne diese Parteitaktik nicht zustande gekommen wäre. Heinz Stockinger betont etwas anderes: „Eine Untersuchung aus dem Jahr 1980 zeigt, dass die Kreisky-Anhänger, die gegen die Atomkraft waren, aber nicht zur Abstimmung gingen, eine größere Anzahl an Stimmen ausgemacht hätten als die ÖVP-Wähler, die nur gegen das Kraftwerk stimmten, um Kreisky eins auszuwischen.“ Ein Vorteil der Atomgegner sei es jedenfalls gewesen, dass sie sich trotz unterschiedlicher Herkunft nicht politisch zerstritten.
1000 Räume
Gespaltene Gegner der Kernspaltung – das wäre so unübersichtlich gewesen wie die über 1000 Räume des AKWs es heute für einen verirrten Besucher wären. Übrigens haben hier nicht nur Muslime gebetet. Der Komplex ist sogar katholisch gesegnet, wie EVN-Konzernsprecher Stefan Zach berichtet, auf dessen Initiative die heutige Öffnung des Ortes beruht. Beim Besuch der Heiligenkreuzer Mönche habe man die Gelegenheit genützt, berichtet er. Freilich war damals der AKW-Betrieb schon lange aufgegeben worden.
Hätte ein Kirchenmann das AKW schon 1978 segnen können? Wie stand die Kirche, die heute die Bewahrung der Schöpfung betont, damals zur Atomkraft? Die Bischöfe mahnten zwar zur Vorsicht, legten sich aber hinsichtlich der Volksabstimmung über Zwentendorf nicht fest. Nur der damalige Präsident der Katholischen Aktion Österreich, Eduard Ploier, gab die Formel aus: Wer Zweifel hat, solle mit Nein abstimmen. Für Elisabeth Sallinger-Leidenfrost war das unbefriedigend: „Die Haltung der offiziellen Kirche war für mich schmerzlich. Ich fand, dass Atomkraft nicht gut mit dem Evangelium zusammengeht. Denn man kann ja die Schädigung des Menschen nicht unter den Tisch fallen lassen und eine Technologie anwenden, ohne zu wissen, was man mit den atomaren Abfallprodukten macht“, erzählt die heutige Krankenhaus-Seelsorgerin. Auch der Perfektionswahn habe sie zweifeln lassen: „Entgegen den Aussagen der Befürworter habe ich mich gefragt: Kann der Mensch etwas Fehlerloses herstellen, sodass keine Gefahr besteht?“ Für sie als Theologin war es schon damals wichtig, dass der Mensch seine Begrenztheit auch annimmt.
Heinz Stockinger hält der Kirche zumindest zugute, dass sie den Atomkraftgegnern Plattformen zur Diskussion geboten hat – vor allem über das Bildungswerk. „Das war eine Chance für unsere Seite. Ich rechne das der Kirche positiv an“, sagt der AKW-Gegner. Diese Diskussionen hätten – wie viele andere Faktoren – zum Nein bei der Volksabstimmung beigetragen.
Ausgeträumt
Mit diesem Nein am 5. November 1978 waren die Atomträume mancher aber nicht ausgeträumt. Das AKW wurde im Konservierungsbetrieb erhalten und eine erneute Abstimmung zur Inbetriebnahme geplant, die sich aber als undurchführbar erwies. Als im März 1985 die Kraftwerksgesellschaft liquidiert wurde, beliefen sich die AKW-Gesamtkosten auf 14 Milliarden Schilling – inklusive der hohen Konservierungskosten. Ob 1985 oder nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 das endgültige Aus für Atomenergie „made in Austria“ gekommen war, ist zwischen Energiewirtschaft und Atomkraftgegnern umstritten. Klar ist aber, dass die Abstimmung 1978 ein entscheidender Punkt für zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich war.
Das AKW selbst steht heute nicht nur für Schulungen und Führungen offen. Es ist auch Filmkulisse und Veranstaltungsort – und erzeugt sogar Strom mit Strahlung: Es sind die Sonnenstrahlen, welche eine Photovoltaik-Anlage mit Energie versorgen. In diese Strahlen tritt der Besucher, wenn er die Anlage wieder verlässt. «
Informationen zu den Führungen im AKW Zwentendorf finden Sie auf:
www.zwentendorf.com. Informationen zur Plattform gegen Atomgefahren sind verfügbar auf: www.plage.at







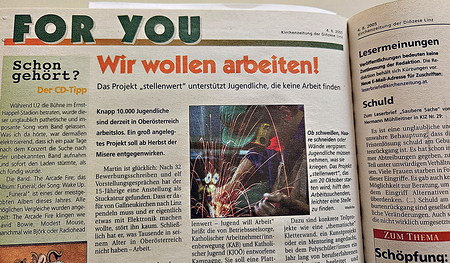
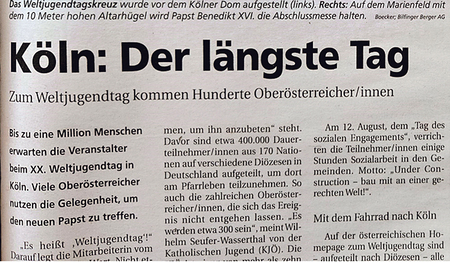


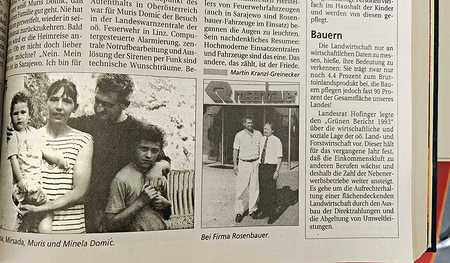

 Jetzt die
Jetzt die