
Wer hat das Zeug zum Arzt oder zur Ärztin?

Dr. Hanl-Andorfer, was sollten junge Menschen für ein Medizinstudium mitbringen?
Monika Hanl-Andorfer: Zum einen Interesse an der Naturwissenschaft, zum anderen die Neugier am Menschen und daran, was ihn bewegt und motiviert. Es geht nicht nur um Krankheitsbilder und Laborwerte, sondern um die Person, die einem gegenübersitzt, mit ihren Wünschen und Sehnsüchten. Für das Studium braucht es viel Ausdauer beim Lernen und gleichzeitig – gegen Ende des Studiums – die Flexibilität, sich in den Strukturen des Gesundheitssystems zurechtzufinden. Die Patientinnen und Patienten präsentieren nicht nur ein Krankheitsbild, sondern oft mehrere gleichzeitig. In der Medizin haben wir viele Spezialisierungen. Dadurch fällt es oft schwer, den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen.
Was müssen angehende Ärztinnen und Ärzte aushalten können?
Hanl-Andorfer: Die Menschen, die als Patientinnen und Patienten zu uns kommen, sind oft in einer Notlage, körperlich und seelisch. Sie sind nicht immer „fit“ und „gestylt“, haben Beschwerden und Symptome, die auch abstoßend, manchmal ekelerregend sein können. Sie fühlen sich in ihrer Not bedroht, erwarten sofortige Hilfe. Die ist naturgemäß nicht immer möglich. Diese Diskrepanz auszuhalten, fällt manchmal schwer.
Was bekommen Ärztinnen und Ärzte zurück?
Hanl-Andorfer: Den Menschen geht es nach der Behandlung meist besser und sie sind dankbar dafür. Am Ende des Tages bleibt die Gewissheit, etwas Sinnvolles getan zu haben. Das spornt immer wieder aufs Neue an. Auch die Freude und Lust am lebenslangen Lernen und der Wissensgewinn können
erfüllend sein.
Das Thema „Zeit“ spielt wahrscheinlich auch eine Rolle …
Hanl-Andorfer: Das ist etwas, was uns Ärztinnen und Ärzte frustriert. Wir wissen, dass wir für ein gutes Gespräch Zeit brauchen, die wir aber oft nicht zur Verfügung haben. Der deutsche Mediziner Giovanni Maio hat einmal in einem Vortrag gesagt: „Wir können viel schneller erledigen, jedoch nicht schneller zuhören.“ Ein Krankenhaus kann man nicht wie eine Firma führen, in der man versucht, in immer kürzerer Zeit und mit weniger Ressourcen mehr zu produzieren. Für gelungene Behandlungen brauchen wir ausreichend Zeit. Mit diesen Schwierigkeiten im System umgehen zu können, erfordert eine gewisse Frustrationstoleranz. Es geht darum, dieses Spannungsfeld auszuhalten, ohne die Menschlichkeit aus dem Auge zu verlieren.
Was gibt Ihnen die Kraft, als Ärztin tätig zu sein?
Hanl-Andorfer: Die Neugierde am Menschen, an der Person mir gegenüber und das Gefühl, dass ich weiterhelfen kann. Erfüllend sind auch gelungene Begegnungen. Als Fachärztin für Psychiatrie gehe ich regelmäßig in Supervisionen, mache interdisziplinäre Teambesprechungen und achte auf ein gutes Arbeitsklima. In der Gruppe trägt man schwierige Situationen leichter. Es braucht Zeiten des Ausgleichs, in denen man zur Ruhe kommen kann, Geborgenheit erlebt und einfach da sein kann, ohne etwas leisten zu müssen. Ich gehe zum Beispiel gerne in der Natur spazieren, verbringe Zeit mit meiner Familie oder lese ein Buch. Spirituell gut gebunden zu sein, zu wissen, egal wie es läuft, da ist noch etwas Stützendes, ich trage nicht alleine die Verantwortung – auch das ist oft sehr hilfreich.
Den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten möchte ich sagen: Wissen allein ist nicht alles. Die Ausbildung ist wichtig, aber sie ist nicht das ganze Leben.




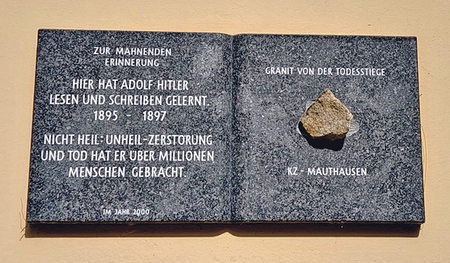

 Jetzt die
Jetzt die