
Vom Sterben der Insekten

Auch die aktuelle Studie eines australischen Forschungsteams zeigt auf, dass Insekten auf dem Weg sind, auszusterben. Der Ökologe Johann Zaller erläutert die Situation.
Was sagen Sie zum Bericht über das Insektensterben? Wie drastisch ist die Lage?
Zaller: Die Situation ist gravierend. Spezialisten wissen das schon sehr lange; aber mit dieser neuen Studie ist es jetzt aktualisiert, dokumentiert und international am Tableau und es wird darüber diskutiert. Es wurde dabei auf 73 Studien weltweit Bezug genommen.
Was sind die, Ursachen für das Insektensterben?
Zaller: Die aktuelle australische Studie nennt als Hauptursache den Rückgang der Lebensräume für die Insekten. Feuchtgebiete, Moore, Teiche sind trockengelegt worden. Bäche mäandrieren nicht mehr, sondern wurden begradigt. Brachflächen, Wegraine und unbehandelte Grünstreifen bei Zäunen, die es früher noch reichlich gab, sind aus unserer Landschaft praktisch verschwunden. Auch durch Monokulturen verlieren die Insekten ihre Nahrungsquellen, weil es dadurch keine Vielfalt, keine Blüten mehr gib. Weitere Ursachen sind chemische Substanzen, Pestizide, Dünger und generell die intensive Bewirtschaftung. Früher sind die Wiesen im Alpenraum zweimal im Jahr gemäht worden – im Frühling gab es die Heumahd und im Hochsommer das Grummet. Jetzt wird fünf- oder sechsmal jährlich gemäht. Wo sollen da Insekten leben? Dazu kommt noch der Faktor, dass so genannten Neobiota, also Organismen, die neu in unserer Fauna und Flora sind, unsere heimischen Insekten verdrängen. Klassische Beispiele sind der asiatische Marienkäfer und eine asiatische Hornissenart.
Um welche Pestizide handelt es sich?
Zaller: Interessant ist, dass die meisten Imker glauben, dass vor allem Insektizide für das Insektensterben verantwortlich sind. Doch negative Auswirkungen auf die Insekten haben genauso Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, und Fungizide, sprich Pilzgifte. Über die Jahrzehnte ist uns durch die Lobbyingarbeit der Agrarchemieindustrie eingebläut worden, dass diese Mittel so spezifisch sind, dass es praktisch keine Nebenwirkungen auf andere Organismen gibt. Dem ist leider nicht so. In aller Munde sind Roundup-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat. Es ist nachgewiesen worden, dass durch diese Unkrautvernichtungsmittel die Honigbienen anfälliger sind für Krankheiten und sie z. B. ihre Darmflora negativ beeinflussen. Bei Pilzgiften weiß man, dass sie oft in Tanks mit bienenungefährlichen Insektiziden vermischt werden, damit der Bauer nicht so oft rausfahren muss. Dadurch entsteht eine so genannte synergetische Wirkung, die eine ganz stark bienengiftige Mischung erzeugt.
Welche Auswirkungen hat das Insektensterben auf Tiere, Pflanzen und Menschen?
Zaller: Große, weil die Insekten sehr viel für uns tun und extrem wichtig sind. Ein Beispiel ist natürlich die Bedeutung der Insekten für die Bestäubung im Obst- und Gemüsebau. In der Landwirtschaft sehen wir sie leider oft als Schädlinge, weil sie Pflanzen wegfressen und uns die Ernteerträge streitig machen; aber ungefähr zehn Prozent der Insekten sind so genannten Parasitoide, die andere Insekten, darunter viele Schädlinge, parasitieren.
Was bedeutet das?
Zaller: Das heißt, sie machen für uns eine Art biologische Kontrolle, ohne dass wir das mitbekommen. Wenn die Insekten nun weniger werden, nehmen in Folge Schadorganismen überhand, weil die natürliche Kontrolle nicht mehr vorhanden ist. Man nimmt an, dass mehr als 50 Prozent der Schädlingskontrolle auf den Feldern auf natürliche Weise stattfindet. Da hängt es natürlich auch davon ab, wie die Landschaft selber ausgestattet ist, ob es eher Monokulturen oder Brachen gibt. Wenn für die Nützlinge noch Platz ist, dann helfen sie uns, Schädlinge unschädlich machen, ohne dass wir zur Spritze greifen müssen.
Welchen Zweck haben die für uns so lästigen Gelsen oder Wespen?
Zaller: Die Angst, von einer Wespe gestochen zu werden, ist oft groß, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns etwas tut, ist sehr gering. Wir sollten eher daran denken, dass sie nützlich sind. Sie fressen nicht nur Nektar und Pflanzen, sondern auch Tierkadaver und lebende Insekten wie Fliegen, Blattläuse und andere Schädlinge. Gelsen und Stechmücken sind z. B. unglaublich wichtig für die Reinhaltung des Wassers, weil sie Verunreinigungen rausfiltrieren. Andererseits sind sie auch wichtiges Futter für Vögel, für Amphibien, für Reptilien usw. Es gibt alle möglichen Gruppen von Insekten – Pflanzenfresser, Fleischfresser, manche besiedeln tierische Organismen, andere fressen Exkremente wie z. B. alle Arten von Mistkäfern. Pferdeknödel auf einem Forstweg oder Kuhfladen auf einer Wiese sind in ein paar Monaten weg – und es sind Insekten, die das wegfressen. Im Prinzip bietet die Natur ein super ausgeklügeltes System.
Man hört, Grünstreifen in der Landwirtschaft mit verschiedenen Pflanzenarten würde gegen das Insektensterben helfen. Ist das so?
Zaller: Es gibt viele Studien, die das nachgewiesen haben. Wenn man z. B. im Gemüseanbau Grünstreifen in die Landschaft einzieht, dann fördert man Nützlinge, darunter, wie schon erwähnt, auch Parasitoide, die helfen, Schädlinge zu bekämpfen. Wichtig ist auch, dass wir mehrere Fruchtfolgen haben, dass wir wieder mehr Diversität in die Landwirtschaft bringen und nicht nur riesige Monokulturen haben mit Mais, Getreide und Weinbau. Wir müssen weg von großen Strukturen. In Österreich haben wir noch relativ kleine Felder und eine reiche Struktur in unserer Landschaft. Das müssen wir behalten, damit das Ökosystem gut funktioniert. In Ländern wie Südamerika mit Feldern von 1.000 Hektar ohne Struktur sieht das anders aus.
Und würden mehr Kleingärten mit Blumen oder weniger Rasenmähen auch helfen?
Zaller: Laut Studien findet man mittlerweile mehr Insektenvielfalt in Kleingärten als in der Agrarlandschaft. Und in den Privatgärten könnte man anfangen, Mut zur Schlampigkeit zu haben. Die Mähroboter, die so modern und ständig im Einsatz sind, schaffen widrige Lebensräume, in denen Insekten nicht überleben können, weil nicht einmal ein Gänseblümchen aufkommen kann. Vermeiden sollte man auch Steingärten, die wenig Lebensraum bieten für Insekten.
Es gibt z. B. in Paris Gebäude, auf denen Bienenvölker leben, um ihnen mehr Lebensraum zu geben. Gibt es das auch in Österreich?
Zaller: Ja, in Wien z. B. auf dem Naturhistorischen Museum oder auf dem Linzer Mariendom. Hilfreich sind auch Flachdachbegrünungen; die Gemeinden könnten dazu beitragen, dass die Straßenränder nicht ständig kurz gestutzt werden. Argumente dagegen sind in Wien, dass dann der Hundekot nicht weggeräumt wird und im Gras verschwinden würde. Oder es kommt die Kritik, wenn nicht gemäht wird, sieht es schlampig aus. Man könnte auch Gemüsegärten und mehr Fruchtbäume wie Kirsch- und Apfelbäume in die Städte bringen. Aber da gibt es Probleme mit dem Fallobst, das lästige Wespen anzieht.
Es braucht ein Umdenken ...
Zaller: Wir brauchen eine andere Einstellung gegenüber unseren Mitorganismen. Allein der Ausdruck Umwelt zeigt, welche Einstellung wir haben: Wir sind im Zentrum und alles andere ist um uns. Vielmehr ist es aber unsere Mitwelt. Die anderen Organismen haben genauso ein Recht auf der Erde zu sein, wie wir. Da braucht es mehr Respekt vor der Natur, die uns im Grunde sauberes Trinkwasser, frische Luft und gesunde Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Was die Insekten betrifft, so kann jeder, der einen Garten hat, etwas tun und wenigstens ein Eckerl wild sein oder Brennnesseln aufkommen lassen. Da kommen dann alle möglichen Schmetterlinge, weil sich die Raupen von den Brennnesseln ernähren.
Buchtipp: Johann G. Zaller: Unser täglich Gift. Pestizide – die unterschätzte Gefahr. Deuticke Verlag, 2018, 240 Seiten, 20,60 €.



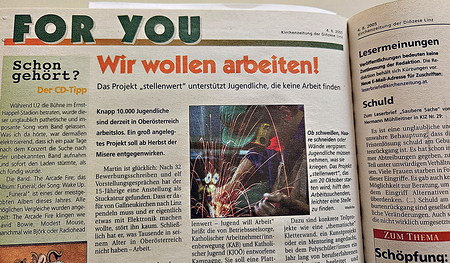
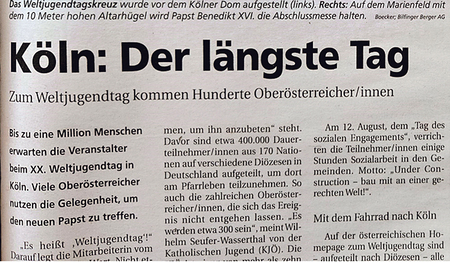


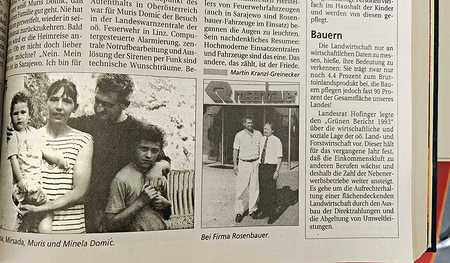

 Jetzt die
Jetzt die