
„Der Prager Frühling war auch ein Frühling für die Kirche“

Herr Bischof, die Kirche in der damaligen Tschechoslowakei hatte in den 1950er Jahren stark unter Verfolgung zu leiden. Welche Bedeutung nahm dann der „Prager Frühling“ für sie ein?
Václav Malý: Er war eine wichtige Phase für die Gesellschaft, auch für die Kirche. In den 1950er Jahren waren viele Priester verhaftet und verurteilt worden, die Bischöfe isoliert oder in Haft. Das Ordensleben war nicht mehr möglich und die Pfarrstrukturen waren beschädigt. Öffentliches Wirken war verboten und kirchliches Leben auf die Kirchengebäude beschränkt. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre kehrten Priester aus den Gefängnissen zurück. Im Prager Frühling wurden sie aktiv. Auch die Bischöfe konnten ihren Platz wieder einnehmen. Der Prager Frühling war auch ein Frühling für die Kirche.
Wie haben Sie selbst diese Phase erlebt?
Malý: Ich war 18 Jahre alt und habe alles mitverfolgt. Es kam das „Werk der konziliaren Erneuerung“ auf, es gab theologische Vorträge und Bücher. Das Zweite Vatikanische Konzil wurde den Gläubigen nahegebracht. Das war eine sehr fruchtbare Zeit, auch im kulturellen Leben: In Prag entstanden neue Theater und Zeitschriften. Ich war begeistert und habe viel gelesen.
Als Beginn des Prager Frühlings gilt der Jänner 1968. Aber offenbar gab es Vorzeichen ...
Malý: Die Lockerung des gesellschaftlichen Systems hatte Anfang der 1960er Jahre langsam begonnen – auch in der Kommunistischen Partei selbst. Im Prager Frühling wurde die Zensur aufgehoben und man sprach von einem „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Doch es war klar: Wenn der Prager Frühling sich fortsetzen würde, dann käme ein demokratisches System. Denn es ging den Menschen nicht um Sozialismus, sondern um Freiheit und Demokratie.
Am 21. August rückten die Truppen des Warschauer Paktes ein. Hatte es zuvor Befürchtungen gegeben, dass so etwas passiert?
Malý: Das war ein Schock. Es gab vorher gewisse Signale, dass etwas passieren könnte. Aber der brutale Einmarsch war in dieser Form nicht erwartet worden. Die Situation blieb im Herbst 1968 noch verhältnismäßig gut. Im Frühling 1969 begannen die Säuberungen in der Kommunistischen Partei selbst: Im April musste Alexander Dubcek zurücktreten. Ab dem Sommer 1969 betrafen die Säuberungen die Gesellschaft und auch die katholische Kirche.
Wie haben Sie selbst den Einmarsch der Truppen am 21. August 1968 erlebt?
Malý: Ich hing – wie viele andere auch – fast durchgehend am Radio. Es waren auch Panzer in meinem Viertel in Prag zu sehen. Ein paar Tage später ging ich demonstrieren.
Wie traf die Niederschlagung des Prager Frühlings die Kirche?
Malý: Die Kirche konnte sich einen gewissen Freiraum bis Mitte 1969 bewahren. Dann konnten die Bischöfe zwar bleiben, aber unbequeme Priester wurden ersetzt, das „Werk der konziliaren Erneuerung“ verboten.
Warum haben Sie sich in dieser Zeit entschieden, Priester zu werden?
Malý: Das hing mit der gesellschaftlichen Situation zusammen. Zunächst wollte ich Archäologie studieren. Nach dem Prager Frühling sah ich aber, wie sich Menschen veränderten und vorsichtiger wurden. Es gab wieder Karrieristen. Ich dachte mir, man könne nicht die persönliche Einstellung und den Glauben ändern, weil sich das System ändert. Als Priester wollte ich zeigen, dass es sich lohnt, das Evangelium zu bekennen.
War es schwierig, das Studium zu beginnen?
Malý: Als ich 1969 an die damals einzige theologische Fakultät nach Leitmeritz kam, gab es noch keine Beschränkung für Studenten, die wie ich kein „Kaderprofil“ hatten – mein Vater hatte als Lehrer seinen Posten verloren. Am Anfang hatten wir noch vom Prager Frühling geprägte Professoren. Doch bald mussten sie gehen, es kamen Zugangsbeschränkungen und wir waren vom internationalen Austausch abgeschnitten.
Sie wurden 1976 zum Priester geweiht und haben im Jahr danach die Charta 77 unterzeichnet, aus der eine Bürgerrechtsbewegung entstand. Warum haben Sie das riskiert?
Malý: Das ist einfach zu erklären: Ich habe in der Kirche gepredigt, dass wir tapfer sein, uns zu Jesus Christus bekennen und in der Wahrheit leben müssen. Mir war aber klar, dass ich auch öffentlich nicht schweigen kann. Die Charta 77 konnte ich inhaltlich mittragen: Ich sagte mir, ich bin ja auch ein Bürger. Daraufhin wurde mir elf Jahre lang verboten, als Priester zu wirken. Ich wurde von der Geheimpolizei verfolgt, geschlagen, war sieben Monate im Gefängnis. Es war für mich dennoch eine sehr wertvolle Zeit, weil ich in dieser Opposition den Dialog mit Menschen ganz unterschiedlicher weltanschaulicher Herkunft führen konnte.
Und Ihr priesterliches Amt?
Malý: Ich war geheim tätig: In Wohnungen oder im Sommer auch im Wald habe ich mit kleinen Gruppen Eucharistie gefeiert. Ich habe Bibelstunden und Vorträge gehalten, Sakramente gespendet und für den Samisdat (Untergrundliteratur, Anm.) geschrieben.
Bei der Samtenen Revolution 1989 traten Sie erneut öffentlich auf: An der Seite von Václav Havel beim Bürgerforum auf dem Wenzelsplatz. Hatten Sie die Befürchtung, dass diese Bewegung wie der Prager Frühling enden könnte?
Malý: Diese Angst war zunächst da. Wir traten auf, nachdem die Polizei Studenten zusammengeschlagen hatte. Es war unser Ziel, den Leuten eine Richtung zu zeigen. Wir haben gesagt, dass es keine Rache geben darf. Es war ein Wunder, dass die Menschen uns angenommen haben. Als zehntausend Arbeiter einer Prager Fabrik zu uns stießen, war für uns klar, dass wir die kritische Masse erreicht hatten.
Wie beschreiben Sie die Lage der Kirche in der heutigen Tschechischen Republik?
Malý: Die Frage der Rückgabe kirchlichen Eigentums ist gelöst. Es liegt jetzt an uns, neue Wege zur Verkündigung des Evangeliums zu finden. Zum Teil erwarten die Menschen mehr von der Kirche, als dass sie sich selbst als aktive und verantwortliche Mitglieder sehen. Wir werden in unserer Arbeit Prioritäten setzen müssen, denn wir sind eine städtische Kirche und keine Volkskirche. In den Städten konzentrieren sich die Gläubigen in guten Pfarrgemeinden. In solch einer Pfarre stoßen vielleicht drei bis vier Personen im Jahr zur Kirche. Das sind junge Menschen, die Verantwortung in sich spüren. Das gibt mir Hoffnung. Wir sind nicht die Kirche der Menge, aber eine Kirche der kleinen Gruppen, die in ihrer Umgebung wirken.
Aus Ihrer Erfahrung gesprochen: Was können wir heute für verfolgte Christen und Kirchen tun?
Malý: Solidarität zeigen! Als Erstes sollten wir regelmäßig beten. Natürlich ist Unterstützung über Hilfsorganisationen wichtig, aber es geht um mehr als Geld. Jeder kann eine Karte an den Diktator eines Landes senden, in dem die Christen verfolgt werden. Wenn es tausende Karten werden, wird er vorsichtiger sein. Wichtig ist es auch, die Menschen zu besuchen. Und wir sollten dankbar sein, dass wir in Freiheit leben dürfen.
Im Überblick
Als „Prager Frühling“ wird ein Öffnungsprogramm tschechoslowakischer Kommunisten und sein Widerhall in der Bevölkerung bezeichnet. Als markantes Datum gilt die Übernahme der Parteiführung durch Alexander Dubcek am 4. Jänner 1968, wobei es schon zuvor Reformtendenzen gab. Unter Dubcek wurden die Pressezensur aufgehoben. In Wirtschaft und Politik wurden Reformpläne entwickelt. In den anderen kommunistischen Staaten, insbesondere in der Sowjetunion, wurde dies als gefährliches Ausscheren der Tschechoslowakei wahrgenommen. Sie fielen am 21. August 1968 in der CSSR ein. Damit begann das Ende des Prager Frühlings.
1977. Die Petition „Charta 77“ schuf eine Bürgerrechtsbewegung. Das Regime reagierte mit Repression gegen die Unterzeichner der Charta.
1989. In der Samtenen Revolution 1989 konnte letztlich der Umbruch in ein demokratisches System friedlich vollzogen werden. Seit 1993 sind Tschechien und die Slowakei zwei unabhängige Staaten.




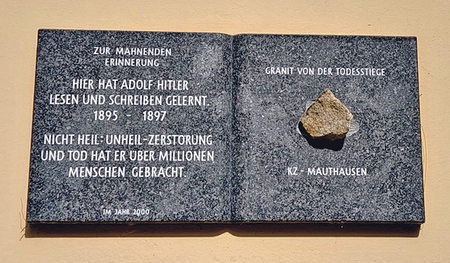

 Jetzt die
Jetzt die