Maria Fischer studierte Theologie und Philosophie. Sie ist Pastoralvorständin der Pfarre TraunerLand in der Diözese Linz.
NS-Opfer P. Paulus Wörndl: „Christus hat mich an sich gezogen“

„Wie heißen Sie?“, fragt der Richter, der hinter einem Tisch steht. Ob der Gefragte jetzt noch eine Antwort gibt, ändert nichts daran, dass er in wenigen Augenblicken sein Leben verliert. Die Frage gehört zum Hinrichtungsritual im Zuchthaus Brandenburg/Havel. Es ist der 26. Juni 1944. Der bereits im April zum Tode Verurteilte, der Karmelit Paulus (August) Wörndl, sagt deutlich seinen Namen. Der Richter fragt weiter: „Sie sind zum Tode verurteilt.
Gestehen Sie Ihre Verbrechen ein?“ „Nein.“ Damit endet der Dialog zwischen dem Verurteilten und dem Richter, der sich an den Scharfrichter wendet: „Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes.“ Wörndl wehrt sich nicht, als er unter das Fallbeil geschoben wird. So hat der Anstaltsseelsorger Anton Scholz das Lebensende von Paulus Wörndl überliefert.
Kindheit in Oberösterreich
1894 kam er in Itzling (heute Stadt Salzburg) zur Welt und erhielt den Taufnahmen August, doch in Oberösterreich aufgewachsen: Schlierbach, Kirchdorf/I., Oberhaid bei Wels und zuletzt Wels sind die Stationen seiner Kindheit.
Zu den Karmeliten
Die Familie pflegt Beziehungen zu den Karmeliten, der junge August tritt selbst nach der Matura in den Orden ein – aus August wird Paulus. Nach verschiedenen Stationen kommt er nach St. Pölten, wird Gründungspfarrer von St. Josef und wirkt dort fast zehn Jahre als angesehener und besonders von jungen Menschen geschätzter Seelsorger.
Das stört die 1938 in Österreich an die Macht gekommenen Nationalsozialisten. Zweimal wird Wörndl wegen angeblicher Devisenvergehen verhaftet – und wieder freigelassen. Schließlich erhält er „Gauverbot“. Der St. Pöltner Bischof Michael Memelauer ernennt ihn noch zum Konsistorialrat, muss ihn aber ziehen lassen. So kommt Wörndl nach Linz an die Karmeliterkirche, wo 1941 eine Pfarrexpositur entsteht, deren Leitung er übernimmt.
Wörndl bleibt brieflich mit seinen einstigen jugendlichen Schützlingen in Kontakt, insbesondere wenn sie an die Front geschickt werden. Dass einer von ihnen sich im Widerstand betätigt, wird ihm zum Verhängnis.
Er wird am 6. Juli 1943 in Linz verhaftet, eine Hausdurchsuchung bringt hinter dem Hochaltar versteckte Briefe zutage. Ob und inwieweit Wörndl von den Widerstandshandlungen seines Briefpartners weiß, bleibt unklar. Um die Anklage zu untermauern, wird ein Sexualdelikt behauptet – für das nie ein Beweis zutage tritt.
„Fanatischer Feind“
Was der eigentliche Grund seines Martyriums ist, wird im Urteil klar: „August Wörndl, von jeher fanatischer Feind unserer nationalsozialistischen Lebensauffassung, hat unter Berufung auf seine Priesterautorität einen deutschen Soldaten fortgesetzt habsburgisch-separatistisch verseucht und ihn darin bestärkt, auch andere hochverräterisch zu zersetzen.“
Wörndl musste sterben, weil er ein Gegner des NS-Regimes war. „Wenn ich auch nicht immer so ganz christustreu war infolge meiner Schwachheit, so hat er mich durch diese Passion ganz an sich gezogen“, hat er seinen Angehörigen aus dem Gefängnis geschrieben.


















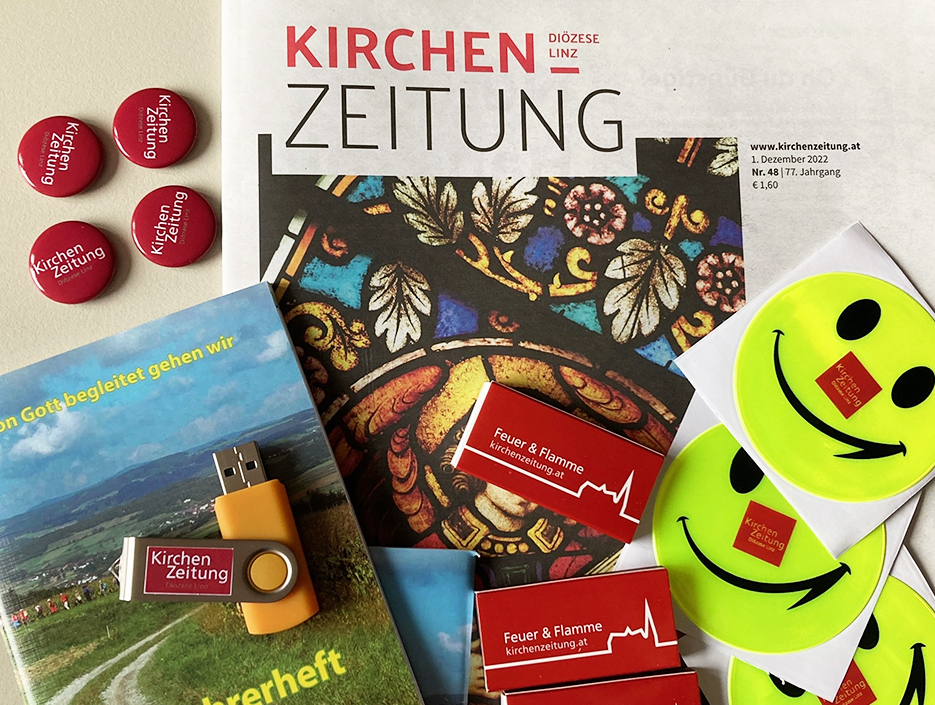
 Jetzt die
Jetzt die