Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.
Das Gegenteil von „America first“ - Bischof Scheuer zu Papst Leo XIV.

Herr Bischof, wie haben Sie die ersten Worte von Papst Leo XIV. aufgenommen?
Bischof Manfred Scheuer: Sie waren sehr gut gewählt und haben Profil gezeigt – etwa, weil das allererste Wort ein Friedenswort war. Aufgefallen sind mir die Dankbarkeit für Papst Franziskus, die Verbundenheit mit Peru, wo er Bischof war, und die Betonung der Synodalität, also des gemeinsamen Weges von Gottes Volk.
Wie beurteilen Sie die Namenswahl? Sie ruft Leo XIII. (1878 – 1903) und Leo I. (ca. 400 – 461), genannt „der Große“, in Erinnerung.
Scheuer: Ich habe gesehen, dass unser neuer Papst nicht nur über Moraltheologie und Kirchenrecht, sondern auch über Patrologie (über die Kirchenväter, Anm.) gelehrt hat. Da liegt Leo I. nahe. Er war Papst in einer Umbruchzeit, einer Epoche der kulturellen Krise, starker Fluchtbewegungen und gewalttätiger Auseinandersetzungen. Im Deutschen heißt diese Zeit „Völkerwanderung“, im Italienischen „Invasioni barbariche“ („Einfälle der Barbaren“). Leo I. war damals eine stabilisierende, ordnende Kraft, die für den Frieden eintrat: Es gelang ihm, Rom ohne Blutvergießen vor den Hunnen zu bewahren. Theologisch ist Leo der Große einerseits mit dem Konzil von Chalcedon verbunden, andererseits mit der Betonung der Würde des Menschen und des Christen bzw. der Christin. Natürlich verweist der Name
Leo auch auf Leo XIII., der im 19. Jahrhundert die Kirche in einer Phase des gesellschaftlichen Umbruchs geleitet hat. Nach der Zeit seines Vorgängers Pius IX. gelang es ihm, die Kirche aus der Verengung zu führen und ihr wieder mehr Gestaltungs- und Spielraum zu öffnen.
Leo XIV. ist der erste Papst aus den USA. Allerdings hat er in seiner ersten Ansprache nur seine Zeit in Peru erwähnt. Wie ist das einzuordnen?
Scheuer: Es ist kein angemessener Zugang, Menschen nur aufgrund ihrer Herkunft in Schubladen zu stecken. Das gilt auch für Leo XIV., der unterschiedliche Wurzeln hat. Erkennbar ist, dass er in Peru starke, auch soziale Erfahrungen gemacht hat. Nicht unterschätzen sollte man seine Zeit in der Leitung des Augustinerordens und in der römischen Kurie. Da muss man dialogfähig sein, in verschiedenen Sprachen nicht nur sprechen, sondern auch zuhören können. Insofern denke ich, dass er wohl das Gegenteil dessen repräsentiert, was der gegenwärtigen US-Regierung vorgeworfen wird. Ein „First“, ein Vorrang für ein bestimmtes Land, ist da nicht möglich, sondern die Betonung der Universalität des Glaubens und der Kirche: Das Gebot der Nächstenliebe endet nicht bei den Landesgrenzen.
Papst Franziskus hat etwas mit Europa gefremdelt. Was ist von Leo XIV. zu erwarten?
Scheuer: Das Fremdeln beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit: Auch viele Europäer – sowohl sogenannte „konservative“ als auch „fortschrittliche“ – haben Franziskus nicht immer verstanden. Was den neuen Papst betrifft, ist das schwierig einzuschätzen. Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit würde ich es ihm zutrauen, dass er sich auf Europa einlässt. Aber wir müssen uns auch damit abfinden, dass Europa nicht mehr das Zentrum der Weltkirche ist, sondern dass es viele Zentren gibt. Immerhin ist Europa der Kontinent, der die lange Tradition der Kirche beheimatet. Persönlich halte ich es für wichtig, zu beachten, dass die Wiege des Christentums im historischen Palästina und in Syrien stand. Das syrische Christentum hat eine ganz eigene Tradition. Es ist wichtig, dass wir uns auch auf diese Wurzel des Glaubens stärker besinnen.
Sie haben in einer ersten Reaktion aufgerufen, für den neuen Papst zu beten. Wofür genau soll man beten?
Scheuer: In der Eucharistiefeier beten wir für und mit dem Papst mit der Intention, dass die Kirche ihre Sendung erfüllen kann. Der Papst steht dabei an zentraler Stelle. Es ist klar, dass dieses Amt für jeden Menschen eine haushohe Überforderung darstellt und immer eine Mixtur aus Gelingen und Versagen ist. Die Kirchenväter haben von den Gezeiten oder Jahreszeiten der Kirche gesprochen. Auch wenn das naturale Bilder sind, so können sie uns doch gelassener machen: Wir erkennen, dass wir etwas nicht unmittelbar erzwingen können – oder müssen. Ich bete also für die individuelle Person, aber auch für die etwas in Vergessenheit geratene „amtliche“ Person des Papstes: Auf diese treffen Erwartungen, Befürchtungen, Ängste, auch Allmachtsfantasieren à la „Wenn ich Papst wäre, würde die Welt anders ausschauen“. Papst Leo XIV. wird selbst als betender Mensch beschrieben. Für ihn wie für uns alle ist die Beziehung mit Gott unersetzlich.


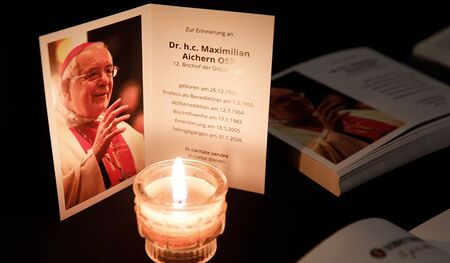
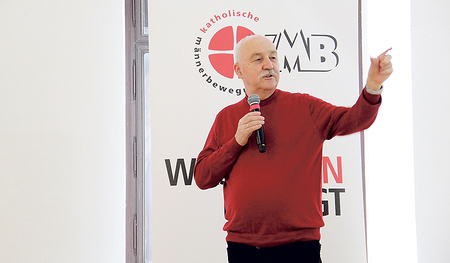


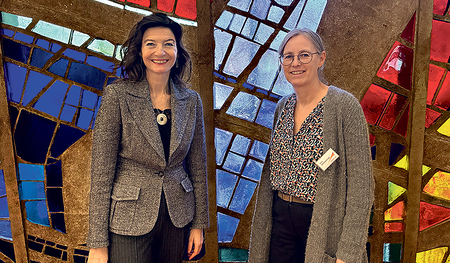
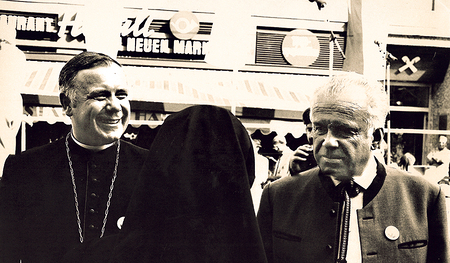







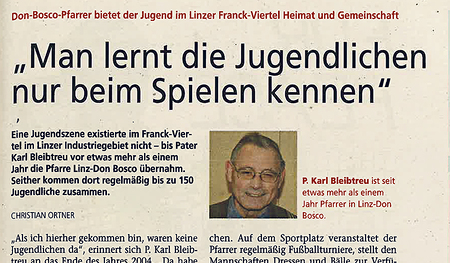


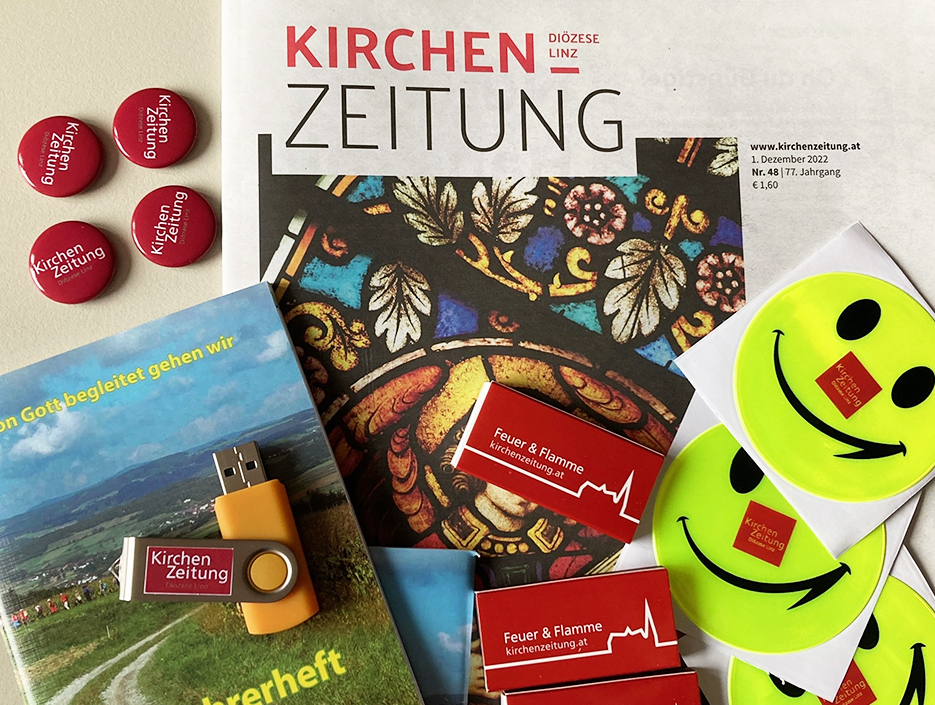
 Jetzt die
Jetzt die