Maria Fischer studierte Theologie und Philosophie. Sie ist Pastoralvorständin der Pfarre TraunerLand in der Diözese Linz.
Aus dem religiösen Buchregal

Glaube
Schon Joseph Ratzinger stand vor der Aufgabe, mit seiner „Einführung in das Christentum“ (1968) auf die Zweifel moderner Menschen zu reagieren: Was heißt „Ich glaube?“ „Was bedeutet Auferstehung?“ War die Auseinandersetzung der 1960er Jahre möglicherweise stark von Anfragen aus der kritischen Studentenbewegung geprägt, so sind es heute häufig konkrete Naturwissenschaften, aus denen Zweifel an Gott und dem christlichen Glauben erwachsen. Besondere Wirkung hatte da zum Beispiel der bekannte Physiker Stephen Hawking.
Mit seinem neuen Buch versucht nun der Theologe und Biologe Ulrich Lüke Antworten zu formulieren – und nimmt sich wie einst Ratzinger das Glaubensbekenntnis (beide Formen) zur Grundlage. Natürlich geht es nicht nur um naturwissenschaftliche Zweifel, sondern zum Beispiel auch um das Problem von Schuld und Sünde.
Das Ansinnen des Autors ist hoch zu loben, nur seien die Leser/innen gleich gewarnt: Es gibt nur wenige relativ einfache Antworten in dem Buch, dafür aber so manche sehr tiefgehende, komplexe Gedankengänge. In jedem Fall kann man viel lernen, auch wenn die Lektüre mühsam ist.
Israel
Pilgerfahrten ins Heilige Land führen Mitteleuropäer in eine religiös, kulturell und politisch andere Welt. Natürlich kann man sich dafür mit vielen verschiedenen Büchern vorbereiten – oder man nimmt ein Werk wie jenes von Wolfgang Sotill zur Hand, in dem Fragen wie „Was macht Jerusalem so heilig, so schwierig, so einzigartig?“ beantwortet werden. Das Buch ist in zwei Teile geteilt: „Land und Leute“ sowie „Judentum – Christentum – Islam“. Es finden sich durchaus auch überraschende Fragen darunter, etwa: „Wie schmeckt koscheres Essen?“ Ob die Antworten auch überraschend sind, liegt im Auge des Betrachters. Freilich: Im Zentrum dieses Buches steht „Israel“ und nicht das „Heilige Land“. Insofern geht es zwar lobenswerterweise viel um das Judentum. Fragen zum Islam oder zu den Palästinensern sind stark unterrepräsentiert. Schade.
Kirchenreform
Aus guten Gründen haben Bücher zur Reform der katholischen Kirche seit geraumer Zeit Konjunktur. Dabei ist festzustellen, dass unter den Autoren solcher Bücher mittlerweile neben Vertretern von Kirchenreformbewegungen Theolog/innen von Universitäten stehen. Einer aus dieser Gruppe ist Daniel Bogner, der in Fribourg in der Schweiz Moraltheologie lehrt. Vieles von dem, was er in seinem Büchlein anspricht, ist nur zu bekannt, etwa die Forderung nach demokratischeren Strukturen und nach Öffnung der Weiheämter. Wer sich also schon lange mit Kirchenreform beschäftigt, wird manch altbekannte Idee finden – was natürlich nicht heißt, dass sie nicht richtig wäre.
Struktur und Geist. Interessant ist die Kritik an Ideen, wonach für eine Kirchenreform „Neuevangelisierung“ und „Mission“ ausreichen. Zurecht argumentiert Bogner, dass Geist und Strukturen nicht auseinanderdividiert werden können. Es wird also nicht ausreichen, das Altbekannte nett zu verpacken. Wie Bogner richtig schreibt: „Was wir brauchen: katholische Identität auf der Höhe der Zeit.“ Dabei geht es ihm aber nicht darum, gute Traditionen zu verdrängen.

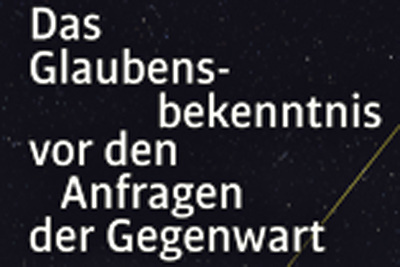

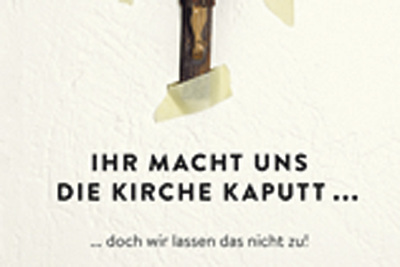

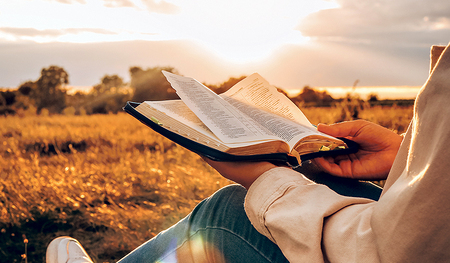
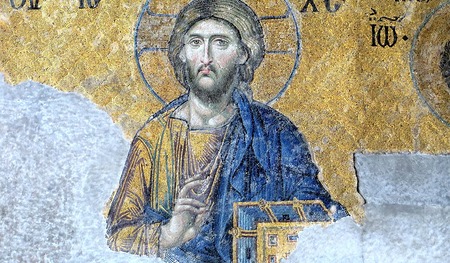




 Jetzt die
Jetzt die