In der Reihe Kunst & Geschichte_n stellt Experte Lothar Schultes Persönlichkeiten vor, die in Kunst und Geschichte wichtige Spuren in Oberösterreich hinterlassen haben.
Die abschlossene Reihe "alt & kostbar" finden sie hier.

Der künstlerische Leiter des Linzer Posthofs siedelt seinen Roman auf dem Gebiet der physikalischen Grundlagenforschung an. Genauer gesagt im Genfer CERN, dem Forschungszentrum für Teilchenphysik. Aber auch Linz ist einer der Schauplätze. Hier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt findet ein Kongress statt, an dessen Vorabend ein Spitzenforscher des CERN ermordet wird.
Mit dem Geständnis seiner Forscherkollegin Jelena Carpova könnte der Fall erledigt sein, handelte es sich um einen Krimi. Doch Steiner lässt seinen Roman damit erst beginnen. Und schickt einen Wiener Wissenschaftsjournalisten und verhinderten Physiker namens Georg Hollaus gemeinsam mit der Anwältin Eva Mattusch unter anderem nach Genf, um die wahren Hintergründe des unglaubwürdigen Geständnisses aufzuklären. In drei Teilen mit insgesamt 27 Kapiteln kann man eintauchen in die faszinierende Welt der Grundlagenforschung und könnte eine Menge über Physik lernen, wenn einem nicht die Grundlagen dazu fehlten. Man erfährt aber auch viel über die Literaturgeschichte, ist doch der Roman Frankenstein, der die Hybris der Naturwissenschaft zum Thema hat, in Genf entstanden. Auch ein rätselhaftes physikalisches Phänomen in Sibirien, das seit mehr als hundert Jahren nicht geklärt ist, beschäftigt die Protagonisten des Romans. Und dann ist es für den Fortgang der Geschichte nicht ganz unwesentlich, wie die handelnden Personen sind und miteinander umgehen. Das zeichnet Steiner mit guter Beobachtungsgabe und feiner Ironie.
Wie es selbst auf dem Feld der Staunen und Ehrfurcht gebietenden Wissenschaft menschelt, wie auch dort Eitelkeiten, Eifersüchteleien, Verrat und Intrige zentrale Triebfedern sind, das macht den lehrreichen Roman unterhaltsam.
Wilfried Steiner: Schöne Ungeheuer. Salzburg – Wien: Otto Müller 2022, 313 S.
Tipp: Wilfried Steiner präsentiert das Buch am Dienstag, 22. März 2022, um 19.30 Uhr im Stifterhaus, Moderation: Sebastian Fasthuber.
Zwei Männer aus unterschiedlichen ideologischen Lagern, die sich als junge Studenten gekannt, gehasst und einander selbst auf persönlicher Ebene nichts geschenkt haben, treffen nach Jahrzehnten zufällig wieder aufeinander und müssen einen Weg finden, mit ihrer unfreiwilligen Abhängigkeit umzugehen. Der eine heißt Dietrich Pernauer, stammt aus einer alten Nazifamilie, ist Mit-glied einer schlagenden Verbindung und lebt ein beschauliches Leben als beamteter Jurist. Der andere, Hans-Werner Hänsel, gehört dem gegenteiligen ideologischen Lager an, ist eine öffentliche Person und auf dem besten Weg, Landesparteivorsitzender der sozialdemokratischen Partei zu werden. Ganz kurz vor diesem Ziel wird er öffentlich beschuldigt, vor zwanzig Jahren eine Studienkollegin sexuell missbraucht zu haben. Hänsel weiß von nichts, kann sich nicht einmal an diese Gretel erinnern und sieht – vorerst einmal – eine Kampagne seiner politischen Gegner, gegen die er sich mit allen Mitteln wehren muss. Bis die Geschichte eine möglicherweise unerwartete Wendung nimmt, lernt man die gesamte Pernauer-Familie kennen, die aus Ewiggestrigen und neuen Rechten besteht, aber auch aus der Esoterik Zugetanen, aus sehr heutigen Taugenichtsen und solchen, die sich von ihrer Herkunft weit abgewandt haben. Man erfährt, wie Fassaden einstürzen und stabile Beziehungen ins Wanken geraten. Eine zentrale Rolle spielt auch ein sanierungsbedürftiges Haus im Besitz der Pernauers. Schacherreiters Stil ist ironisch und unterhaltsam, wenn auch nicht frei von Klischees. Und wenn es auch nicht als Warnung in der Einleitung steht: Ähnlichkeiten mit bekannten lebenden und verstorbenen Personen sind nicht zufällig, sondern könnten beabsichtigt sein.
Christian Schacherreiter: Das Liebesleben der Stachelschweine.
Salzburg – Wien: Otto Müller 2022, 267 S.
Christian Schacherreiter präsentiert den Roman am Freitag, 25. März 2022, um 20 Uhr im Linzer Posthof, Moderation: Manfred Mittermayer.
Die ehemalige Burgschauspielerin, Sängerin und mehrfach ausgezeichnete Autorin Erika Pluhar erzählt die Geschichte einer Frau, die zu Beginn der 90er-Jahre alle Brücken zu ihrer Herkunft abbricht, um einen selbstbestimmten Lebensweg als Journalistin einzuschlagen. In Wien sieht sie dafür keine Möglichkeit. Hals über Kopf und ohne Abschied von der – geliebten – Großmutter, bei der sie als Vollwaise aufgewachsen ist, verlässt sie ihre Heimatstadt, um schreibend ihren Platz in der sich verändernden Welt zu finden. Es ist die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Vaclav Havel, mit dessen literarischem Werk sie sich während ihres Studiums auseinandergesetzt hatte, ist ihr Idol. Etwa 25 Jahre später, als 51-Jährige, kehrt Hedwig Pflüger in die ererbte Wohnung ihrer zwei Jahre zuvor verstorbenen Großmutter in Wien zurück und denkt über das weitgehende Scheitern ihrer eigenen Ansprüche nach. Auf zwei Ebenen faltet die Autorin das Leben ihrer Protagonistin aus. Auf der Suche nach Selbsterkenntnis und wohl angetrieben von ihrem schlechten Gewissen, beginnt Hedwig, kaum angekommen in der Wohnung ihrer Kindheit und Jugend, einen Brief an die Großmutter zu schreiben, in dem sie ihr Leben Revue passieren lässt und über die Beweggründe ihres jahrzehntelangen Schweigens nachdenkt. Das schildert die Autorin recht lebensnah als eine große emotionale Herausforderung für Hedwig. Zu deren Glück erfindet sie den idealen Mann, der Hedwig gleich an ihrem ersten Tag in Wien über den Weg läuft und auf dessen Unterstützung sie für eine erfreuliche Zukunft bauen kann. Selbstbestimmung, eine Schimäre?
Erika Pluhar: Hedwig heißt man doch nicht mehr.
Salzburg – Wien: Residenz Verlag 2021, 315 S.
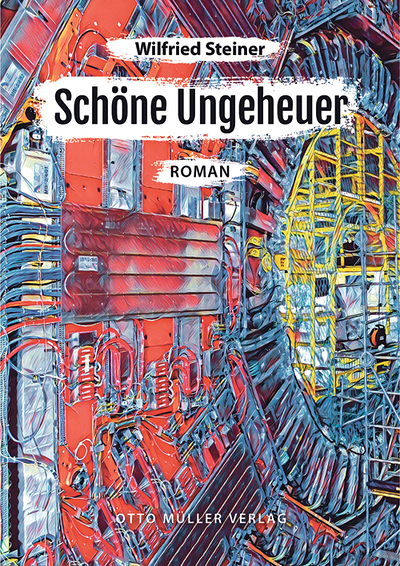
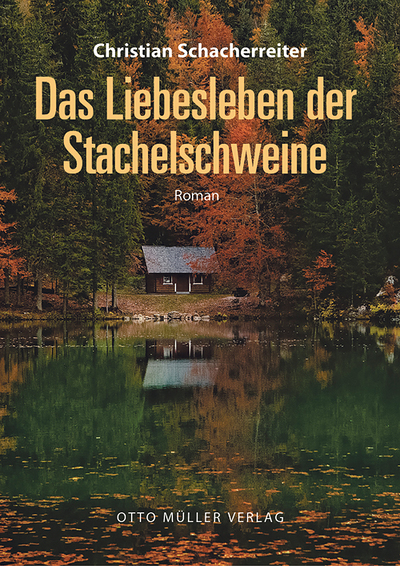
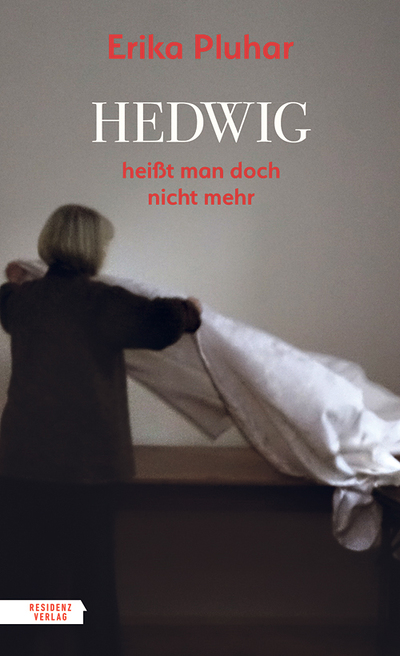
In der Reihe Kunst & Geschichte_n stellt Experte Lothar Schultes Persönlichkeiten vor, die in Kunst und Geschichte wichtige Spuren in Oberösterreich hinterlassen haben.
Die abschlossene Reihe "alt & kostbar" finden sie hier.
BÜCHER_FILME_MUSIK
 KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>
MEIST_GELESEN